|
Sammelband-1
Konfessionelle Bildung in der Diaspora  |  |
Günther Dichatschek
 | | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |
|
|
Vorbemerkung  |  |
"Wer lernt, dazulernt und nicht stehen bleibt, wirkt auf andere jung - egal, ob er zwanzig oder achtzig Jahre alt ist" (Elke GRUBER 2007, 27).
"Ausbildung ohne Bildung führt zu Wissen ohne Gewissen" (Daniel GOEUDEVERT 2001, 5).
Die Auswahl und Anordnung der Themen beruhen auf persönlicher beruflicher Sozialisation und stellen persönliche Schwerpunktbildungen und Interessenslagen dar.
Basis der Beiträge und des Erkenntnisstandes ist die Literatur der Erziehungswissenschaft, Organisationsentwicklung ("Organisation und Pädagogik"), Politischen Bildung, Vorberuflichen Bildung, Altersbildung und Evangelischen Erwachsenenbildung/ EEB sowie interdisziplinärer Ansätze, exemplarisch vom Autor in Evangelischer Erwachsenenbildung/ EEB mit eigenen Arbeiten ausgeführt.
Die Auseinandersetzung mit der Basisliteratur vervollständigt erwachsenenpädagogische Herausforderungen (vgl. beispielhaft LENZ 1998, SEIVERTH 2002, SCHRÖER 2004, PFÄFFLI 2005, RAITHEL - DOLLINGER - HÖRMANN 2005, 219-227; WAHL 2006, WITTPOTH 2006, SANDER 2007, GRUBER - KASTNER - BRÜNNER - HUSS - KÖLBL 2007, SCHEMMANN 2007, NOLDA 2008, DÖRING 2008, ZUMBACH - ASTLEITNER 2016, TIPPELT - HIPPEL 2009, NUISSL - LATTKE - PÄTZOLD 2010, FLEIGE 2011, KRÄMER - KUNZEW -KUYERS 2013, BRAUER 2014, SCHEIDIG 2016; DICHATSCHEK 2005ab, 2007, 2008abc 2017; ARNOLD - NUISSL - ROHS 2017, WALZER 2019).
Einrichtungen und Organisation der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung/ EB - WB müssen in einer sich ständig ändernden Gesellschaft bestehen können, um Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durchführen zu können. Dies bedeutet eine zunehmende nationale (A) und internationale Bedeutung (EU) des quartären Bildungssektors (vgl. WITTPOTH 2006, 107-173).
Der Autor bezieht sich in seinen Ausführungen auf seine postgraduale Ausbildung im 10. Universitätslehrgang "Politische Bildung" / Universität Salzburg bzw. Klagenfurt/ Modul 6 "Die EU und Österreich" - 8 "Normen, Werte, geistige und weltanschauliche Grundlagen der Demokratie"/ Masterstudium (vgl. DICHATSCHEK 2008a, 133-136; FLEIGE 2011, 70), den 6. Universitätslehrgang "Interkulturelle Kompetenz" / Universität Salzburg/ Diplom mit einer Abschlussarbeit zur "Interkulturellen Erwachsenenbildung in der Vorberuflichen Bildung" sowie seine Qualifizierung in der "Weiterbildungsakademie Österreich/ wba" und im Comenius - Institut/ Fernstudium Grundkurs Erwachsenenbildung/ EKD, in Verbindung mit Bildungsmaßnahmen der Personalentwicklung der Universität Wien in "Change Management", "Führung und Management" und "Didaktischen Kompetenzen" und die Absolvierung des 4. Internen Lehrgangs für Hochschuldidaktik der Universität Salzburg/ Zertifizierung.
Ebenso konnte der jahrelange Tätigkeits- bzw. Erfahrungsbereich im Bildungsmanagement als Mitglied der Bildungskommission der Generalsynode der Evangelischen Kirche A. und H.B. (2000 - 2011) und stv. Leiter des "Evangelischen Bildungswerks in Tirol" (2004 - 2009, 2017 - 2019) bzw. als Bildungsbeirat (2011 - 2017) und als Lehrbeauftragter der Universitäten Wien und Salzburg, Lehrerbildner/ PI Tirol und Kursleiter an Salzburger Volkshochschulen eingebracht werden.
Elemente erwachsenenpädagogischer Lehre werden auch im universitären Bereich von Lehrenden verwendet (vgl. WAHL 2006, 6-7). Die Diskussion - insbesondere unter der Prämisse eines "lebensbegleitenden Lernens" - wird hochschuldidaktisch unterschiedlich geführt.
Differenziert wird das Segment Weiterbildung und des Widerstandes gegen Bildung gesehen (vgl. AXMACHER 1990, 20; HOLZER 2017, 191-289).
Unterschiedlich wird die Thematik von Parallelstrukturen in der Didaktik von Schule, Hochschule und EB/ WB behandelt (vgl. NOLDA 2008, 15; PFÄFFLI 2005; DUMMANN - JUNG - LEXA - NIEKRENZ 2007; FLEIGE 2011, 53; BOLDER 2011, 53-66; GRUNDKURS ERWACHSENENBILDUNG/ EKD - COMENIUS INSTITUT, STUDIENBRIEF 3, 2014).
Die Dokumentation ist eine persönliche Auseinandersetzung aus der angeführten Motivation.
Literaturhinweise
Amt und Gemeinde (2010): Schwerpunktnummer "Migration einst und heute", Heft 3/2010
Arnold R. - Nuissl E. - Rohs M. (2017): Einführung in die Erwachsenenbildung. Eine Einführung in Grundlagen, Probleme und Perspektiven, Baltmannsweiler
Axmacher D. (1990): Widerstand gegen Bildung - Zur Rekonstruktion einer verdrängten Welt des Wissens, Weinheim
Baethge M. (1999): Subjektivität als Ideologie. Von der Entfremdung in der Arbeit zur Entfremdung auf dem Arbeitsmarkt?, in: Schmidt G.(Hrsg.): Kein Ende der Arbeitsgesellschaft. Arbeit, Gesellschaft und Subjekt im Globalisierungsprozess, Berlin, 29-44
Bandura A. (1977): Social Learning Theory, New York
Bechtel M. - Lattke S. - Nuissl E. (2005): Porträt Weiterbildung Europäische Union, Bielefeld
Becker M. - Gracht H. von der (2014): Lernen im Jahr 2030 - Von Bildungsavataren, virtuellen Klassenräumen und Gehirn - Doping in der Führungs- und Fachkräfteentwicklung, Institute of Corporate Education, Berlin
Beer W. - Cremer W. - Massing P. (Hrsg.) (1999): Handbuch politische Erwachsenenbildung, Schwalbach/ Ts.
Beher K. - Liebig R. - Rauschenbach T. (2000): Strukturwandel des Ehrenamtes - Gemeinwohlorientierung im Modernisierungsprozess, Weinheim
Beinke L. (2006): Berufswahl und ihre Rahmenbedingungen. Entscheidungen im Netzwerk der Interessen, Frankfurt/ M. -Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien
Bergauer A. - Dvorak J. - Stinner G. (2016): Zur Entwicklung der Erwachsenenbildung in Österreich nach 1945, Bd. 2 der Schriftenreihe "Wiener Moderne" des Instituts für Wissenschaft und Kunst(WK), Frankfurt/ M.
Bolder A. - Hendrich W. (2000): Fremde Bildungswelten. Alternative Strategien lebenslangen Lernens, Opladen
Bolder A. (2011): Das lebenslange Lernen, die Beteiligung daran und die Bildungspolitik. Und das lebenslange Lernen, die Beteiligung...., in: Holzer D. - Schröttner A. - Sprung A. (Hrsg.) (2011): Reflexionen und Perspektiven der Weiterbildungsforschung, Münster - New York - München - Berlin, 53-66
Boronski F. (1986): 40 Jahre Heimvolksschule Bildungszentrum Jagdschloss Göhrde, Göhrde
Brauer M. (2014): An der Hochschule lehren. Praktische Ratschläge, Tricks und Lehrmethoden, Berlin - Heidelberg
Brödel R. - Nettke T. - Schütz J. (Hrsg.) (2014): Lebenslanges Lernen als Erziehungswissenschaft, Bielefeld
Busse von Colbe W. - Coenenberg A.G. - Kajüter P. - Linnhoff U. - Pellens B. (Hrsg.) (2011): Betriebswirtschaft für Führungskräfte. Eine Einführung für Ingenieure, Naturwissenschaftler, Juristen und Geisteswissenschaftler, Stuttgart
Bücker N. - Seiverth A. (2019): Erwachsenenbildung. Empirische Befunde und Perspektiven. Evangelische Bildungsberichterstattung, Bd. 3, Münster
Datta A. (Hrsg.) (2005): Transkulturalität und Identität. Bildungsprozesse zwischen Exklusion und Inklusion, Frankfurt/M.
Detel W. (2007): Habermas und die Methodologie kritischer Theorien, in: Winter R. - Zima P. v.(Hrsg.): Kritische Theorie heute, Bielefeld, 177-202
Deutscher Bildungsrat (1970): Empfehlungen der Bildungskommission. Strukturplan für das Bildungswesen, Bad Godesberg
Dichatschek G. (2005a): Maßnahmen in der Lehrerbildung zur Verhinderung von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit. Ein Beitrag zur politischen Bildung/Erziehung in Österreich, in: Erziehung und Unterricht 3-4/2005, 357-367
Dichatschek G. (2005b): Theorie und Praxis evangelischer Erwachsenenbildung, in: AMT und GEMEINDE, Heft 7/8 2005, 126-130
Dichatschek G. (2007): Lebens- und Lernbedingungen von Kindern und Heranwachsenden in der EU. Ein Beitrag zur politischen und Menschenrechtsbildung im Rahmen von "Education for Democratic Citizenship", In: Erziehung und Unterricht 1-12/2007, 129-138
Dichatschek G. (2008a): Politische Bildung in Schloss Hofen - Rückblick, Rundblick und Ausblick eines Teilnehmers, in: Klepp C.-Rippitsch D. (Hrsg.) (2008): 25 Jahre Universitätslehrgang Politische Bildung in Österreich, Wien, 133-136
Dichatschek G. (2008b): Aspekte der vorberuflichen Bildung in Schule und Hochschule, in: Erziehung und Unterricht 5-6/2008, 445-451
Dichatschek G. (2008c): Geschichte und Theorieansätze der politischen Bildung/Erziehung in Österreich - unter besonderer Berücksichtigung vorberuflicher Bildung/Erziehung. Master Thesis: Universitätslehrgang MSc - Politische Bildung, Alpen-Adria? Universität Klagenfurt/Fakultät für Kulturwissenschaft, Juni 2008
Dichatschek G. (2012/2013): Ehrenamtlichkeit in der Erwachsenenbildung, in: AMT und GEMEINDE, Heft 4, 2012/2013, 688-692
Dichatschek G. (2015): Mitarbeiterführung von Ehrenamtlichen, Saarbrücken
Dichatschek G. (2017): Erwachsenen- bzw. Weiterbildung. Ein Beitrag zu Theorie und Praxis von Fort- bzw. Weiterbildung, Saarbrücken
Dichatschek G. (2018): Theorie und Praxis Evangelischer Erwachsenenbildung. Evangelische Erwachsenenbildung bzw. Weiterbildung und Religionslehrerausbildung in Österreich - Politische Bildung, Saarbrücken
Dichatschek G. (2020): Erwachsenenpädagogik - Theorie, Praxis und Professionalität in Volkshochschulen und Weiterbildung, Saarbrücken
Dietrich St. (2001): Zur Selbststeuerung des Lernens, in: Dietrich St.(Hrsg.): Selbstgesteuertes Lernen in der Weiterbildungspraxis, Bielefeld, 19-28
Dobischat R./ Hufer Kl. - P. (Hrsg.) (2014): Weiterbildung im Wandel. Profession und Profil auf Profitkurs, Schwalbach/Ts,
Döring K.W. (2008): Handbuch Lehren und Training in der Weiterbildung, Weinheim-Basel?
Dummann K.-Jung K.-Lexa S.-Niekrenz Y. (2007): Einsteigerhandbuch Hochschullehre. Aus der Praxis für die Praxis, Darmstadt
Ehses Chr./Heinen-Tenrich J./Zech R. (2001): Das lernorientierte Qualitätsmodell für Weiterbildungsorganisationen, Hannover
Eis A.-Salomon D. (Hrsg.) (2014): Gesellschaftliche Umbrüche gestalten. Transformationen in der Politischen Bildung, Schwalbach/Ts.
Engartner T. (2010): Didaktik des Ökonomie- und Politikunterrichts, Paderborn
Erler I. (2014): Erwachsenenbildung in Zeiten der Unsicherheit, in: Erler I. - Holzer D. - Kloyber Chr. - Schuster W. -Vater St. (Hrsg.): Wenn Weiterbildung die Antwort ist, was war die Frage?, Schulheft 156/2014, Innsbruck, 49-60
Eß O. (Hrsg.) (2010): Das Andere lernen. Handbuch zur Lehre Interkultureller Handlungskompetenz, Münster - New York -München - Berlin
Europäische Kommission (2000): Memorandum über lebenslanges Lernen. Materialien zur Erwachsenenbildung Nr. 1/2001, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien 2001
Europäische Kommission (2001): Mitteilung der Kommission. Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen, Brüssel/ 21.11.2001, KOM (2001) 678
Europäische Kommission (2006): Mitteilung der Europäischen Kommission. Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus, Brüssel/ 23. 10.2006, KOM (2006) 614
Europäische Kommission (2007): Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Aktionsplan Erwachsenenbildung. Zum Lernen ist es nie zu spät, Brüssel/27.9.2007, KOM(2007)558
Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium im Comenius - Institut (2013/2014): Grundkurs Erwachsenenbildung, Frankfurt/ M.
Evangelischer Oberkirchenrat A. und H.B.: Kundmachung vom 24. März 1997, Zl. 2630/97 "Kommission für Bildungsarbeit/Arbeitsauftrag der Bildungskommission"
Faltermaier T. - Mayring P. - Saup W. - Stremel P. (2002): Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters, Stuttgart
Faustich P. - Bayer M. (Hrsg.) (2006): Lernwiderstände. Anlässe von Vermittlung und Beratung, Hamburg, 26-38
Faustich P. - Zeuner Chr. (2001): Erwachsenenbildung und soziales Engagement, Bielefeld
Faulstich P. - Zeuner Chr. (2006/2008): Erwachsenenbildung. Eine handlungsorientierte Einführung in Theorie, Didaktik und Adressaten, Weinheim
Faulstich P. (2013): Menschliches Lernen. Eine kritisch-pragmatische Lerntheorie, Bielefeld
Festinger L. (2012): Theorie der kognitiven Dissonanz, Bern
Filla W. (2014a): Kritische Erwachsenenbildung - Kritik in der Erwachsenenbildung, in: Erler I. - Holzer D. - Kloyber Chr. - Schuster W. - Vater St. (Hrsg.): Wenn Weiterbildung die Antwort ist, was war die Frage?, in: Schulheft 156/2ß014, Innsbruck, 28-36
Filla W. (2014b); Von der freien zur integrierten Erwachsenenbildung. Zugänge zur Geschichte der Erwachsenenbildung in Österreich, Frankfurt/ M.
Fieldhouse R. (2004): Communita Education, in: Federighi P. - Nuisll E. (Hrsg.): Weiterbildung in Europa. Begriffe und Konzepte, Bonn, 37 >  http://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2000/federighi00_01.pdf (3.6.2013) http://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2000/federighi00_01.pdf (3.6.2013)
Finckh H.J. (2009): Erwachsenenbildungswissenschaft. Selbstverständnis und Selbstkritik, Wiesbaden
Fleige M. (2009): Diskurse über Lernkulturen in der Erwachsenenbildung und ihr Beitrag zur transkulturellen Bildungsarbeit, in: Gieseke W. - Robak S. - Wu - L. (Hrsg.) (2009: Transkulturelle Perspektiven auf Kulturen des Lernens, Bielefeld, 169-188
Fleige M. (2011): Lernkulturen in der öffentlichen Erwachsenenbildung. Theorieentwickelnde und empirische Betrachtungen am Beispiel evangelischer Träger - Internationale Hochschulschriften, Bd. 554, Münster
Forneck H.J. (2006): Selbstlernarchitekturen, Baltmannsweiler
Forneck H.J. (2009): Die Bildung erwachsener Subjektivität - Zur Gouvernementalität der Erwachsenenbildung, in: Giesecke W./ Robak S./ Wu M. - L. (Hrsg.)(2009): Transkulturelle Perspektiven auf Kulturen des Lernens, Bielefeld, 67-102
Forneck H.J. (2005): Ein parzelliertes Feld. Eine Einführung in die Erwachsenenbildung, Bielefeld
Gagel W. (2000): Einführung in die Didaktik des politischen Unterricht. Ein Studienbuch, Opladen
Gieseke W./ Robak S./ Wu M.-L. (Hrsg.)(2009): Transkulturelle Perspektiven auf Kulturen des Lernens, Bielefeld
Goeudevert D. (2001): Der Horizont hat Flügel. Die Zukunft der Bildung, München
Göhlich M. (2006): Transkulturalität als pädagogische Herausforderung, in: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 4/2006, 2-7
Gruber E. (2007): Alter und lebenslanges Lernen, in: Gruber E.-Kastner M.-Brünner A.-Huss S.-Kölbl K. (Hrsg.): Arbeitsleben 45plus. Erfahrungen, Wissen & Weiterbildung - Theorie trifft Praxis, Klagenfurt, 15-29
Gruber E. - Kastner M. - Brünner A. - Huss S. - Kölbl K. (Hrsg.) (2007): Arbeitsleben 45plus. Erfahrungen, Wissen & Weiterbildung - Theorie trifft Praxis, Klagenfurt
Gruber E. - Wiesner G. (Hrsg.) (2012): Erwachsenenpädagogische Kompetenzen stärken. Kompetenzbilanzierung für Weiterbildner/ innen, Bielefeld
Gruber E. - Lenz W. (2016): Erwachsenen- und Weiterbildung Österreich, Bielefeld
Hacker W. (1986): Arbeitspsychologie - Psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten, Bern
Hastedt H. (Hrsg.) (2012): Was ist Bildung. Eine Textanthologie, Stuttgart
Heckhausen H. (1989): Motivation und Handeln, Berlin
Heckhausen H. - Gollwitzer P.M. (1986): Information processing before and after the formation of an intent, in: Klix F. - Hagendorf H. (Hrsg.): Human Memory and cognitive capabilities: Mechanismen and performances, Amsterdam, 1071-1082
Hellmuth Th. - Klepp C. (2010): Politische Bildung. Geschichte - Modelle - Praxisbeispiele, UTB 3222, Wien - Köln -Weimar
Heran - Dörr E./ Kahlert J./ Wiesner H. (2007): Lehrerfortbildung zwischen Theorie und Praxis. Erfahrungen mit einem unterrichtsbezogenen Konzept, in: Die Deutsche Schule 3/2007, 357-366
Hermann U. (2012): Neurodidaktik - neue Wege des Lehrens und Lernens, in: Hermann U. (Hrsg.): Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen, Weinheim, 9-17
Herold S. - Herold M. (2011): Selbstorganisiertes Lernen in Schule und Beruf. Gestaltung wirksamer und nachhaltiger Lernumgebungen, Weinheim-Basel?
Heyse V.-Erpenbeck J. (2009): Kompetenztraining. 64 Mudulare Infomations- und Trainingsprogramme für die betriebliche, pädagogische und psychologische Praxis, Stuttgart
Hippel A. von/Tippelt R. (Hrsg.) (2009): Fortbildung der Weiterbildner/innen. Eine Analyse der Interessen und Bedarfe aus verschiedenen Perspektiven, Weinheim-Basel?
Holzer D. (2017): Weiterbildungswiderstand. Eine kritische Theorie der Verweigerung, Bielefeld
Holzer D. - Schröttner B. - Sprung A. (Hrsg.) (2011): Reflexionen und Perspektiven der Weiterbildungsforschung, Münster - New York - München - Berlin
Höher F. - Höher P. (1999): Handbuch Führungspraxis Kirche. Entwickeln - Führen - Moderieren in zukunftsorientierten Gemeinden, Gütersloh
Huber W. (1998): Kirche in der Zeitenwende. Gesellschaftlicher Wandel und Erneuerung in der Kirche, Gütersloh
Hufer Kl.-P. (2007): Politische Bildung in der Erwachsenenbildung, in: Sander W. (Hrsg.): Handbuch politische Bildung, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 476, Bonn, 300-311
Hufer Kl.-P. (2016): Politische Erwachsenenbildung. Plädoyer für eine vernachlässigte Disziplin, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1787, Bonn
Hufer Kl.-P./Richter D. (Hrsg.) (2013a): Politische Bildung als Profession. Verständnisse und Forschungen. Perspektiven politischer Bildung, Bonn
Hufer Kl.-P./Richter D. (Hrsg.) (2013b): Politische Bildung als Profession. Verständnisse und Forschungen, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1355, Bonn
Illeris K. (2006): Das "Lerndreieck". Rahmenkonzept für ein übergreifendes Verständnis vom menschlichen Lernen, in: Nuissl E. (Hrsg.) (2006): Vom Lernen zum Lehren. Lern- und Lehrforschung für die Weiterbildung, Bielefeld, 29-41
Illeris K. (2010): Lernen verstehen: Bedingungen erfolgreichen Lernens, Bad Heilbrunn
Kasper H. - Mayrhofer W. (Hrsg.) (2002): Personalmanagement - Führung - Organisation, Wien
Kauffeld S. (2016): Nachhaltige Personalentwicklung und Weiterbildung. Betriebliche Seminare und Trainings entwickeln, Erfolge messen, Transfer sichern, Berlin - Heidelberg
Klampfer A. (2005): Wikis in der Schule. Eine Analyse der Potentiale im Lehr-/ Lernprozess, Abschlussarbeit im Rahmen der B.A.-Prüfung im Hauptfach Erziehungswissenschaft/ Lehrgebiet Bildungstechnologie - Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften der Fern Universität in Hagen
Klingovsky U. (2009): Schöne neue Lernkultur? Transformationen der Macht in der Weiterbildung. Eine gouvernementalitätstheoretische Analyse, Bielefeld
Knoll J. (2003): Etwas bewegen wollen - Lernunterstützung für ehrenamtliche Vereinsarbeit, Berlin
Knowles M.S. - Holton E. - Swanson R.A. (2007): Lebenslanges Lernen. Andragogik und Erwachsenenlernen, München
Kolb D.A. (1984): Experiential learning. Experience as the Source of Learning and Development, Englewood Cliffs
Köcher R. - Bruttel O. (2013): Generali Altersstudie 2013. Wie ältere Menschen leben, denken und sich engagieren (Originalausgabe), Frankfurt/M.
Küchler F. von (2007): Von der Rechtsformveränderung zur Neupositionierung - Organisationsveränderungen als zeitgenössische Herausforderungen der Weiterbildung, in: Küchler F. von (Hrsg.): Organisationsveränderungen von Bildungseinrichtungen. Vier Fallbeispiele für den Wandel in der Weiterbildung, Bielefeld, 7-29
Krämer H. - Kunze A.B. - Kuypers H. (Hrsg.) (2013): Beruf: Hochschullehrer. Ansprüche, Erfahrungen, Perspektiven, Paderborn
Kruse A. - Rudinger G. (1997): Lernen und Leistung im Erwachsenenalter, in: Weinert F. - Mandl H. (Hrsg.) (1997): Psychologie der Erwachsenenbildung, Göttingen, 45-85
Langenohl A. - Polle R. - Weinberg M. (Hrsg.) (2015): Transkulturalität. Klassische Texte, Bielefeld
Lehr U. (2005): Heute gejagt - morgen gefragt?, in: Weiterbildung, Heft 3, 20-23
Lenk Chr.(2010): Freiberufler in der Weiterbildung. Empirische Studie am Beispiel Hessen, Bielefeld
Lenz W. (Hrsg.) (1998): Bildungswege. Von der Schule zur Weiterbildung, Innsbruck
Lenz W. (1999): On the Road Again. Mit Bildung unterwegs, Innsbruck
Lipowsky F. (2004): Was macht Fortbildung für Lehrkräfte erfolgreich?, in: Die Deutsche Schule 96/2004, 462-479
Locke E.A. - Latham G.P. (1990): A theory of goal setting and Task performance, Englewood Cliffs, NJ
Maslow A. (1960): Motivation and Personality, New York
Massing P. (2013): Was ist Politik? Definition und Zusammenhänge, in: Hufer Kl.-P./ Länge Th./ Menke B./ Overwien B./ Schudoma L. (Hrsg.): Wissen und Können. Wege zum professionellen Handeln in der politischen Bildung, Schwalbach/ Ts., 100-102
Massing P. (2014): Theoretische Grundlagen für die Praxis politischer Bildung, in: Lange D.-Oeftering T. (Hrsg.): Politische Bildung als lebenslanges Lernen, Schwalbach/Ts., 75-8
Mecheril P. (2004): Einführung in die Migrationspädagogik, Weinheim
Mecheril P.-Seukwa L. (2006): Transkulturalität als Bildungsziel? Spektische Bemerkungen, in: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 4/2006, 8-13
Meueler E. (2009): Didaktik der Erwachsenenbildung - Weiterbildung als offenes Projekt, in: Tippelt R. - v. Hippel A. (Hrsg.) (2009): Handbuch Erwachsenenbildung/ Weiterbildung, Wiesbaden, 973-987
Mollenhauer Kl. (2007): Erziehung und Emanzipation, in: Baumgart H. (Hrsg.): Erziehungs- und Bildungstheorien. Erläuterungen - Texte - Arbeitsaufgaben, Bad Heilbrunn, 251-259
Negt O. (1991): Phantasie, Arbeit, Lernen, Erfahrung - Zur Differenzierung und Erweiterung der Konzeption "Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen", in: Arbeit und Politik - Mitteilungsblätter der Akademie für Arbeit und Politik an der Universität Bremen, H. 8/1991, 11-15
Negt O. (1997): Kindheit und Schule in einer Welt der Umbrüche, Göttingen
Negt O. (2012): Gesellschaftsentwurf Europa, Göttingen
Negt O. (2014): Politische Bildung und Europäische Integration - Ein lebenslanger Lernprozess für alle Europäer, in: Lange D.-Oeftering T. (Hrsg.): Politische Bildung als lebenslanges Lernen, Schwalbach/Ts, 15-22
Nipkow K.E. (1991): Lebensbegleitung und Verständigung in der pluralistischen Gesellschaft. Erwachsenenbildung in evangelischer Verantwortung, in: Friedenthal-Hasse? M. u.a. (Hrsg.): Erwachsenenbildung im Kontext, Bad Heilbrunn, 75-89
Noe R.A.(2003): Employee Training and development, New York
Nolda S. (2004): Das Verdrängen des Lerners durch das Lernen. Zum Umgang mit Wissen in der Wissensgesellschaft, in: Meister D.M. (Hrsg.) (2004): Online-Lernen? und Weiterbildung, Wiesbaden, 29-42
Nolda S. (2008): Grundwissen Erziehungswissenschaft. Einführung in die Theorie der Erwachsenenbildung, Darmstadt
Nuissl E. (2016): Keine lange Weile. Texte zur Erwachsenenbildung aus fünf Jahrzehnten, Bielefeld
Nuissl E. - Lattke S. - Pätzold H. (2010): Europäische Perspektiven der Erwachsenenbildung. Studientexte für Erwachsenenbildung, Bielefeld
Opaschowski H.W. (2006a): Das Moses Prinzip. Die 10 Gebote des 21. Jahrhunderts, Gütersloh
Opaschowski H.W. (2006b): Einführung in die Freizeitwissenschaft, Wiesbaden
Opaschowski H.W. (2006c): Deutschland 2020. Wie wir morgen leben - Prognosen der Wissenschaft, Wiesbaden
Öztürk H. (2014): Migration und Erwachsenenbildung. Studientexte zur Erwachsenenbildung, Bielefeld
Peters R. (2004): Erwachsenenbildungsprofessionalität. Ansprüche und Realitäten, Bielefeld
Pfäffli B.K. (2005): Lehren an Hochschulen. Eine Hochschuldidaktik für den Aufbau von Wissen und Kompetenzen, Bern-Stuttgart-Wien?
Pongratz H. - Voß G.G. (2003): Arbeitskraftunternehmer: Erwerbsorientierung in entgrenzten Arbeitsformen, Berlin
Pries L. (2001): Internationale Migration, Bielefeld
Pries L. (2006): Verschiedene Formen der Migration - verschiedene Wege der Integration, in: neue praxis, Sonderheft 8/2006: Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft, 19-28
Raithel J. - Dollinger B. - Hörmann G. (2005): Einführung Pädagogik -Begriffe. Strömungen. Klassiker. Fachrichtungen (Erwachsenenbildung), Wiesbaden
Reifenhäuser C. - Hoffmann S.G. - Kegel Th. (2009): Freiwilligen - Management, Augsburg
Reischmann J. (2001): Ist Professionswissen lehrbar?, in: Dewe B. - Wiesner G. - Wittpoth J.:(Hrsg.): Professionswissen und erwachsenenpädagogisches Handeln. Dokumention der Jahrestagung der Sektion Erwachsenenbildung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 2001, Beiheft zum Report, Bielefeld, 81-88
Robak S. (2009): Kulturelle Aspekte von Lernkulturen in transnationalen Unternehmen unter Globalisierungsbedingungen, in: Gieseke W./ Robak S./ Wu M. -L. (Hrsg.) (2009): Transkulturelle Perspektiven auf Kulturen des Lernens, Bielefeld, 119-150
Rohe K. (1994): Politik. Begriffe und Wirklichkeiten: Eine Einführung in das politische Denken, Stuttgart - Berlin -Köln
Sajikumar S.R. - Morris G.M. - Korte M. (2014): Competition between recently potentiated synaptic Inputs reveals a winner-take-all Phase of synaptic tagging and capture, in: Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America 11(33), 12217-12221
Sander W. (Hrsg.) (2007): Handbuch politische Bildung. Lizensausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 476, Bonn
Schäfer E. (2017): Lebenslanges Lernen, Heidelberg
Schäffter O. (2007): Erwachsenenpädagogische Institutionenanalyse. Begründungen für eine lernfördernde Forschungspraxis, in: Heuer U. - Siebers R. (Hrsg.)(2007): Weiterbildung am Beginn des 21. Jahrhunderts. Festschrift für Wiltrud Gieseke, Münster - New York - München - Berlin, 354-370
Scheidig F. (2016): Professionalität politischer Erwachsenenbildung zwischen Theorie und Praxis. Eine empirische Studie zu wissenschaftsbasierter Lehrtätigkeit, Bad Heilbrunn
Schemmann M. (2007): Internationale Weiterbildungspolitik und Globalisierung, Bielefeld
Scherb A. (2010): Der Beutelsbacher Konsens, in: Lange D. - Reinhardt V.(Hrsg.)(2010): Strategien der politischen Bildung. Handbuch für den sozialwissenschaftlichen Unterricht, Basiswissen politische Bildung, Bd. 2, Baltmannsweiler, 31-39
Schiele S. (2004): Ein halbes Jahrhundert staatliche politische Bildung in Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte/ApuZ 7-8/2004, 3-6
Schmidt G. (2000): Wandel und Kontinuität. Wohin sich die Arbeitsgesellschaft entwickelt, in: Schüler: Arbeit Heft 2000, 57-61
Schröer A. (2004): Change Management pädagogischer Institutionen. Wandlungsprozesse in Einrichtungen der Evangelischen Erwachsenenbildung, Opladen
Schröder B. (2012): Religionspädagogik, Tübingen
Schubert H. (Hrsg.) (2008): Netzwerkmanagement. Koordination von professionellen Vernetzungen - Grundlagen und Beispiele, Wiesbaden
Schuller T. u.a. (2005): The benefits of learning. The impact of education on helath, family life and social capital, London
Schwendemann N. (2018): Werthaltungen von Lehrkräften in der Erwachsenenbildung, Wiesbaden
Schwenk E.- Klier W. - Spanger J. (2010): Kasuistik in der Lehrerbildung. Seminardidaktische Impulse für eine praxis-, problem- und teilnehmerorientierte Arbeit mit angehenden Lehrerinnen und Lehrern, Baltmannsweiler
Seitter W. (2013): Profile konfessioneller Erwachsenenbildung, Heidelberg
Seiverth S.A. (Hrsg.) (2002): Re - Visionen Evangelischer Erwachsenenbildung. Am Menschen orientiert, Bielefeld
Skinner B.F. (1982): Jenseits von Freiheit und Würde, Reinbek
Spitzer M. (2006): Lernen: Die Entdeckung des Selbstverständlichen, Weinheim
Steinert H. (2007): Das Verhängnis der Gesellschaft und das Glück der Erkenntnis: Dialektik der Aufklärung als Forschungsprogramm, Münster
Terhart E. (2003): Wirkungen von Lehrerbildung: Perspektiven einer an Standards orientierten Evaluation, in: Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung 3/2003, 8-19
Thomé M. (Hrsg.) (1998): Theorie Kirchenmanagement. Potentiale des Wandels - Analysen - Positionen - Ideen, Bonn
Tietgens H. (1997): Was bleibt in der Lerngesellschaft für die Bildung?, in: Erwachsenenbildung Heft 4/1997, 161-163
Tietgens H.- Weinberg J. (1971): Erwachsene im Feld des Lehrens und Lernens, Braunschweig
Tippelt R. v. Hippel A. (Hrsg.) (2009): Handbuch Erwachsenenbildung - Weiterbildung, Wiesbaden
Tiroler Tageszeitung, Nr. 83/Oktober 2011: Sonderbeilage "Moment" - Schwerpunktthema "Kirche und Bildung"
UNESCO (2010): Global Report on Adult Learning and Education, Hamburg
Vanderheiden E./ Mayer Cl. -H. (Hrsg.) (2014): Handbuch Interkulturelle Öffnung. Grundlagen - Best Practice-Tools?, Göttingen
Wahl D. (2006): Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln, Bad Heilbrunn
Wahl D. (2020): Wirkungsvoll unterrichten in Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung. Von der Organisation der Vorkenntnisse bis zur Anbahnung professionellen Handelns, Bad Heilbrunn
Walzer N. (Hrsg.) (2019): Die Bildung der Menschlichkeit für Erwachsenen. Schritte zur Gesellschaft von morgen, Wien
Weinberg J. (2000): Einführung in das Studium der Erwachsenenbildung, Bad Heilbrunn
Welsch W. (1997): Transkulturalität. Die veränderte Verfassung heutiger Kulturen, in: Schneider I. - Thomsen C. (Hrsg.) (1997): Hybridkultur. Meiden, Netze, Künste, Köln, 67-90
Werner D. (2006): Trends und Kosten der betrieblichen Weiterbildung. Ergebnisse der IW - Weiterbildungserhebung 2005, in: IW - Trends. Vierteljahreszeitschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 33(1), 1-19
Widmaier B. (2014): Non - formale Politische Bildung. Eine evidenzbasierte Profession? in: Lange D. - Oeftering T. (Hrsg.): Politische Bildung als lebenslanges Lernen, Schwalbach/ Ts., 69-81
Wittpoth J. (2006): Einführung in die Erwachsenenbildung. Bd. 4 Einführungstexte in die Erziehungswissenschaft, Opladen & Farmington Hills
Wolf. A. (Hrsg.) (1998): Der lange Anfang. 20 Jahre "Politische Bildung in den Schulen", Wien
Wood R.E. - Bandura A. (1989): Social cognitive theory of organizational management, in: Academy of Management Review 14/3, 361-384
Zech R. (2003): Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung. LQT 2. Das Handbuch, Hannover
Zeuner Chr. (2010): Erwachsenenbildung: Entwicklung einer kritischen Diskussion, in: Lösch B. - Thimmel A. (Hrsg.): Kritische politische Bildung. Ein Handbuch, Schwalbach/ Ts., 53-64
Zeuner Chr. (2011): Forschung zur politischen Erwachsenenbildung zwischen Theorie und Praxis. Überlegungen und Perspektiven, in: Journal für politische Bildung 2/2011, 37-46
Zeuner Chr. (2013): Erwachsenenbildung und Profession, in: Hufer Kl.-P./ Richter D. (Hrsg.): Politische Bildung als Profession. Verständnisse und Forschungen - Perspektiven Politischer Bildung, Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 1355, Bonn, 81-95
Zeuner Chr. (2014): Theorie und Praxis der politischen Erwachsenenbildung: ein "gestörtes Verhältnis"?, in: Lange D. -Oeftering T. (Hrsg.): Politische Bildung als lebenslanges Lernen, Schwalbach/ Ts. 85-95
Zumbach J.- Astleitner H. (2016): Effektives Lehren an der Hochschule. Ein Handbuch zur Hochschuldidaktik, Stuttgart
1 Einleitung Ziele - Konzepte  |  |
Für die Evangelische Erwachsenenbildung/ EEB gehören theologische Ziele zum Selbstverständnis.
So wird beispielsweise die Theorie der EEB "[...]innerhalb der Praktischen Theologie (als ein) Teil einer übergreifenden Theorie kirchlicher Bildungsverantwortung, die die Handlungsfelder in Kirche und Gesellschaft umfasst, sich nach leitenden theologischen und pädagogischen Kriterien kohärent und einheitlich unbeschadet innerer Differenzierung begründet, Glaubensinterpretationen und Bildungskriterien grundsätzlich aufeinander bezieht und als wissenschaftliche Theorie hermeneutisch - kritisch einer immer schon theoretischen Praxis aufklärend und handlungsorientiert" beschrieben (NIPKOW 1991, 76).
Konzepte für neue Zugangsmöglichkeiten/ Bildungsangebote sind notwendig geworden (dialogische Formen - Seminare -Erkundungen - Projekte - Workshops - Studientage; Bedürfnisse von Kirchendistanzierten/ Themenwahl, Räumlichkeiten; Orientierung an der Lebenswelt der Adressaten; SCHRÖDER 2012, 500, 504-505).
Zunehmend gibt es differenzierte Erwartungen an Religion und Kirchen. Jedenfalls nimmt der traditionelle "Kirchenchrist" ab. Hier ist anzusetzen. Unterschieden wird bei Kirchenmitgliedern in "Humanisten" (Pflege des kulturellen Erbes), "Alltagschristen" (Übereinstimmung von Wort und Tat), "Anspruchsvollen" (Individualität der Glaubensvorstellung und des Gottesbildes) und "Jugendlichen" (Lust und Spontaneität - Distanz und Kritik).
EEB versteht sich als Zugang für Kirchendistanzierte (vgl. SCHÖER 2004, 38-39).
Die Forderung der EU nach "lebensbegleitendem Lernen" mit Weiterbildung ist in der EEB ausbaufähig.
Inwieweit eine Ehrenamtsausbildung ausreicht, ist klärungsbedürftig, weil es ebenso um die Gruppe der nebenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen als Adressaten/innen geht.
Jedenfalls geht es um die Frage des Nachwuchses und der Verteilung der Tätigkeitsbereiche, um EEB durchführen zu können (vgl. dazu den Beitrag zum Workshop "Ehrenamtlichkeit/Freiwilligkeit in der Erwachsenenbildung"; DICHATSCHEK 2012/2013, 688-692; IT - Autorenhinweise:  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Personalentwicklung). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Personalentwicklung).
Im Folgenden wird verkürzt und übersichtlich der "Grundkurs Erwachsenenbildung( 2018)" der Evangelischen Arbeitsstelle Fernstudium im Comenius - Institut Frankfurt/ M. als eine Form der Fort- bzw. Weiterbildung angesprochen (vgl.  http://www.fernstudium-ekd.de [27.3.2018]). http://www.fernstudium-ekd.de [27.3.2018]).
1 Einführungsheft
Fernlernen leicht gemacht
Der Grundkurs Erwachsenenbildung
Einführung in das Thema
Weiterführende Literatur
2 Studienbrief 1 Bildung
Zielsetzung - Einleitung
Bildung im Spannungsfeld von Ich und Gesellschaft
Inhalte, Themen und Ziele
Bildung - Beispiele theoretischer und politischer Konzepte
Zukunftsaufgabe Bildung
Schlussfolgerungen für die Erwachsenenbildung
Literatur
3 Studienbrief 2 Lernen
Zielsetzung - Einleitung
Lernen im Erwachsenenalter
Was passiert im Gehirn? Zur Biologie des Lernens
Theorien des Lernens
Lernen als individuelles Verhalten
Schlussfolgerungen für die Erwachsenenbildung
4 Studienbrief 3 Methodik und Didaktik
Einleitung
Die Rolle des Erwachsenenbildners
Veranstaltungen planen
Veranstaltungen durchführen
Veranstaltungen auswerten
Verwendete Literatur
5 Studienbrief 4 Gesellschaft im Wandel
Einführung
Lebensformen im Wandel
Alltag im Wandel
Globalisierung
Postmoderne Gesellschaft
Reflexiver Kosmopolitismus
Schlussfolgerungen für die Erwachsenenbildung
Literatur
Für jeden Studienbrief sind Angebote für auszuführende Aufgaben zu den verschiedenen Themenbereichen vorhanden.
Am Ende der Bearbeitung der vier Studienbriefe ist eine Hausarbeit im Umfang von rund 20 Seiten zur Zertifizierung abzufassen.
Aus Sicht des Autors wären zusätzliche Studienbriefe zu den Themenbereichen "Bildungsmanagement" und "Evangelische Erwachsenenbildung/ Religionspädagogik" wünschenswert.
Eine Kooperation mit der "Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Bildungswerke/ AEBW" wäre ebenso günstig.
Biblische Impulse für Erziehung und Bildung
Die Erziehungsfrage ist sehr wohl mit der Bibel verbunden, gerade der neutestamentliche Text beschreibt einen Erziehungsauftrag, wobei der Ausdruck "Zurechtweisung" als Erziehung heute zu verstehen ist (vgl. 2Tim 3, 16-17). Ziel einer Erziehung ist eine ganzheitliche Erziehung und Ausbildung - verbunden mit Selbständigkeit - in allen Lebensbereichen (vgl. Spr 1,2; Spr 15,33; Jes 26,9; Jes 32,4; Tit 3,14).
Entscheidend sind grundlegende Werte, nicht die Übernahme eines Lebensstils der Eltern. Dies bedeutet für unsere Zeit etwa interkulturelle Kompetenz und die Beachtung des Wertekatalogs der Zehn Gebote. Hier gilt in einem Lernprozess das Verständnis und die Handlungsmöglichkeiten/Umsetzung zu wecken (vgl. Spr 28,7; 5Moses 6, 20-25).
1 Im Alten Testament wird insbesondere die Bedeutung elterlicher Erziehung im 5. Buch Moses deutlich (vgl. 5Moses 6, 5-9). Neben der Wissensvermittlung geht es auch um Lebensvermittlung, also beispielhaftes Zusammenleben nach den Geboten (vgl. 5 Moses 11, 18-21; "soziales Lernen").
2 Neben den Geboten ist das "Buch der Sprüche" das große Erziehungsbuch der Bibel. Thema ist hier eine ganzheitliche Erziehung, die soziales Lernen durch Arbeit, Vorsorge, Frieden stiften und Gerechtigkeit anspricht (vgl. Spr 9,10; ähnlich Spr 1,7; Spr 15,33 - Hiob 28,28 und Ps 111,10). Die angesprochene "Weisheit" bedeutet nicht nur eine intellektuelle Fähigkeit, vielmehr auch die Fähigkeit einer Umsetzung des Wissens durch Erfahrung in die Praxis(vgl. Spr 4,1-9; Handlungskompetenz).
3 Im Alten Testament gibt es keine Hinweise auf ein Schulwesen, vielmehr aber werden Erziehung und Bildung angesprochen. bezogen wird dies hauptsächlich auf die Eltern. Sie sollen Wissen, religiöse und kultische Bildung vermitteln: "Höre mein Sohn, auf die Mahnung des Vaters/ und die Lehre deiner Mutter verwirf nicht" (Spr 1,8). Das hohe Bildungsideal zeigt sich in der Kenntnis der Torah (Gesetz, Unterweisung), die mit der erwähnten Weisheit zu verbinden war. Biblische Bildung war untrennbar mit religiösen Aspekten verbunden. Bei Moses erfährt man seine gründliche Ausbildung und seinen daraus folgenden Einfluss in Ägypten.
4 Das Neue Testament kennt "Schulen". So wurde Paulus erzogen, lernte ein Handwerk (Tuchmacher) und wurde nach dem "Gesetz der Väter" ausgebildet. Eine Biographie von Jesus liegt nicht vor, wohl Hinweise auf einen Bildungsprozess (Tempel, Handwerk). Modern ausgedrückt bedeutet dies einen Hinweis auf "duale Ausbildung".
5 Die Bibel kennt überdies für unsere Zeit einen interessanten Ansatz. In Mt 11,29 lädt Jesus alle ein, von ihm zu lernen (etwa Freundlichkeit, Sanftmut und Verzicht auf Gewalt - "soft kills"). Heute spricht man in diesem Zusammenhang von "lebensbegleitendem Lernen".
Daneben enthält die Bibel viele Lebensregeln und ethische Anweisungen für alle Menschen, beispielhaft
- die Gewaltvermeidung/ 3. Seligpreisung,
- Barmherzigkeit,
- Verzeihen - Lernen,
- Ehrung der Eltern,
- Dankbarkeit,
- Ehrfucht und
- ökologisches Bewusstsein (gegenüber der Schöpfung).
3 Hochschulgemeinde Klagenfurt Migration - Vortrag 2016  |  |
Hintergrund einer Bearbeitung der Migrantenproblematik ist
1 die Vermeidung von Gewaltphänomenen,
2 die Förderung einer zeitgemäßen gesellschaftlichen Integration mit einer Bearbeitung kulturell - religiöser Aspekte unter Beachtung migrationspädagogischen Elemente und
3 Hinweise für bildungspolitische Konsequenzen.
Österreich hat eine lange Tradition im Zusammenleben verschiedener Ethnien. Wien ist historisch multikulturell. Benötigt wird ein Einwanderungskonzept auf nationaler und EU - Basis.
Nach 1945 kam es zu bedeutenden Migrationsbewegungen in Österreich mit Flüchtlingen auf Grund des Zweiten Weltkrieges, 1956 den Ungarnflüchtlingen, 1964 der Anwerbung türkischer und 1966 der Anwerbung jugoslawischer Arbeitskräfte, 1968 Flüchtlingen des "Prager Frühlings", 1980 Flüchtlingen der Aufstände in Polen und letztlich dem Versuch einer gesetzlichen Regelung 1976 mit dem Ausländer - Beschäftigungsgesetz und 1989/90 der Einreise - Einzugsregelung/ TU - YU.
Entsprechend spricht man von einer 1. Generation ("Gastarbeiter"), einer 2. Generation, einer "between" - Generation (Kinder/ Jugendliche, die während der Schul- bzw. Ausbildungszeit nach Österreich kamen) und einer 3. Generation (Kinder der 2. Generation).
Unter religiös - kulturellen Aspekten entstanden christliche Migrationsgemeinschaften, hauptsächlich in Wien: ca. 30 fremdsprachige katholische Gemeinden und serbisch - orthodoxe, russisch - orthodoxe, koptische, syrisch- orthodoxe sowie äthiopisch - orthodoxe Gemeinden.
Nach Artikel 25 Kirchenverfassung i.d.g.F. kommt es zur Bildung von "Personalgemeinden" in der Evangelischen Kirche (u.a. Koreanische -, Finnische -, Schwedische -, Ungarische -, Ghanaische -, Japanische -, Taiwanesische- und Afrikaans Evangelische Gemeinde).
1912 kam es zu einem eigenen Islamgesetz, 1979 zur Gründung der "Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich" und 1989 zur Anerkennung der Sunnitischen und Schiitischen Rechtsschulen durch den Obersten Gerichtshof. In Österreich gibt es über 150 Moscheen/ Gebetsstätten, zumeist als "Kulturvereine" organisiert. Durch die staatliche Anerkennung gibt es islamische Bildungseinrichtungen mit konfessionellem Status (und staatlicher Schulaufsicht).
Mit der Diskussion um die Aufnahme der Türkei in die EU ist der Islam öffentlich in das Interesse gerückt (vgl. die Kopftuch - Debatte ohne Relevanz in Österreich, Parallelgesellschaften im EU - Vergleich in Österreich unauffällig). Bezeichnend ist die Unwissenheit über Islam/ Koran auf Seiten der Nicht - Muslims, auf Seiten der Muslims das Desinteresse an der Religion/ Weltanschauung der österreichischen Wohnbevölkerung.
Nur in der Schule gibt es eine geregelte Sprachpolitik in Form von "Deutsch als Zweitsprache", "Muttersprachlichem Unterricht"/ Bikulturalität und dem Unterrichtsprinzip "Interkulturelles Lernen". Eine Sprachförderung für Migrationskinder mit Eltern wurde im Bundesland Vorarlberg begonnen.
Eine spezifische Beratung für Migrantinnen und Migranten gibt es in Wien und den Landeshauptstädten (mit Mädchenberatung). In ländlichen Regionen versucht das Arbeitsmarktservice/ AMS mit gezielter Beratung zu helfen.
Das pädagogische Prinzip der Transkulturalität betont im Gegensatz zur Interkulturalität - mit dem Kennzeichen der Betonung von Differenzen/ Unterscheidungen - Gemeinsamkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Fremdverstehen. Der Terminus bezeichnet eine Kulturgrenzen überschreitende Kooperation und Gestaltung von EB/WB.
Transkulturalität kann demnach sowohl Kennzeichen transnationaler Staatenbünde als auch benachbarter Regionen oder verschiedenster Bevölkerungsgruppen innerhalb einer nationalstaatlichen Gesellschaft/ Minderheit sein. Von Bedeutung ist die heutige Durchmischung von Kulturformen unterschiedlicher Landeskulturen. Ziel ist ein Erreichen einer entsprechenden Handlungskompetenz für das Individuum (vgl. WELSCH 1997, 67-90; DATTA 2005; ROBAK 2009, 138; ESS 2010; FLEIGE 2009, 170 und 2011, 49). Transkulturelle Kompetenz gewinnt angesichts der laufenden Pluralisierungsprozesse an Bedeutung. Kulturelle Vielfalt, unterschiedliche Werte und Normen bedürfen qualifizierter Basisqualifikationen, also eines Fachwissens, einer geordneten Lebens- und Erfahrungswelt, einer Motivation und der Einbeziehung persönlicher Interessen.
Der Wert von Bildung steigt zunehmend in der Gesellschaft, d.h. schulische und berufliche (Aus-)Bildung entscheidet über die Lebensqualität. Vorberufliche Bildung/ Erziehung ("Berufsorientierung") mit Unterricht, Realbegegnungen und Beratung sind Lebenshilfen und Lebensberatung. Die Studie "Analyse der Kunden/ innen - Gruppe/ Jugendliche mit Migrationshintergrund am Wiener AMS Jugendliche" (AMS Wien 2007) weist auf ein Überdenken der bisherigen Maßnahmen hin. So stammen 66 Prozent der arbeitslosen Heranwachsenden aus Zuwandererfamilien. Große Nachteile durch Sprachdefizite hat die zweite Generation. Die Deutsch - Noten stimmen nicht mit den tatsächlichen Sprachkenntnissen überein. Äußerliche Merkmale diskriminieren Heranwachsende bei der Kontaktaufnahme mit künftigen Arbeitsgebern. Traditionsbewusste Migrantenvereine hemmen mitunter bei der Laufbahnplanung (Mädchen). Eltern (wie Kinder) haben mitunter ein niedriges Bildungsniveau. Notwendig ist eine zusätzliche Ausbildung/ Schulung für AMS - Mitarbeiter/ innen.
Vorberufliche Bildung für Migranten benötigt Migranten/ innen als Berater/ innen, mehrsprachige Folder/ Filme und Netzwerke für Migranten. Folgerungen wären etwa eine Stärkung der Ressourcen bei der Ausbildung, im Beruf, in Familien, Nutzung der Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit und Karriereplanung, Aufbau von Jugendaktivitäten mit inter-ethnischen Freundschaften und einer realistischen Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten wie Ethnie - Kultur, Religion und Nationalität. Ebenso notwendig ist ein Abbau von Sprachbarrieren, Erkennen gemeinsamer Interessen/ "Transferstellen", Strategien von Ausgrenzungserfahrungen/ Abbau von Rassismus, der Respekt von Unterschieden und letztlich eine Aufwertung der Migrationspädagogik (vgl. PRIEL 2001, 2006; MECHERIL 2004; GÖHLICH 2006).
Literaturhinweis/ Auswahl:
Amt und Gemeinde (2010): Schwerpunktnummer "Migration einst und heute", Heft 3/2010
Aslan E. (Hrsg.) (2009): Islamische Erziehung in Europa, Kap. "Muslime in Österreich und das Modell Österreich", Wien - Köln - Weimar, 325-350
Boss - Nünning U./ Karakasoglu Y. (2005): Viele Welten leben. Zur Lebenssituation von Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund, Münster - New York - München - Berlin
Datta A. (Hrsg.) (2005): Transkulturalität und Identität. Bildungsprozesse zwischen Exklusion und Inklusion, Frankfurt/ M.
Eß O. (Hrsg.) (2010): Das Andere lehren. Handbuch zur Lehre Interkultureller Handlungskompetenz, Münster - New York -München - Berlin
Fischer V. - Springer M. (Hrsg.) (2011): Handbuch Migration und Familie. Grundlagen für die Soziale Arbeit mit Familien, Schwalbach/ Ts.
Hempelmann R. (Hrsg.) (2006): Leben zwischen den Welten. Migrationsgemeinschaften in Europa, EZW - Texte Nr. 187/2006, Berlin
4 Bildungswochen 2018 im diakonischen Umfeld  |  |
4.9. - 31.10.2018, Ort: Superintendentur Innsbruck, Rennweg 13
Das Evangelische Bildungswerk in Tirol bot im September und Oktober 2018 eine Reihe von Seminarvorträgen aus dem diakonischen Bereich an.
Schwerpunkte bilden
- diakonisch - soziolpolitisches Lernen (Politische Bildung),
- diakonisch - gesundheitspädagogisches Lernen (moderne Altenbetreuung) und
- diakonisch - soziokulturelles Lernen. Dazu gibt es zunächst eine Ausstellung unter dem Titel "Heimat und Fremde".
Die Vorträge sollen einen Einblick in interessante Themen geben,
- die einerseits mit Mündigkeit, Demokratieverständnis und allgemeiner Politischen Bildung zu tun haben,
- andererseits dem weiten Bereich der Versorgung älterer Mitbürger_innen Rechnung tragen.
Die Termine sind als Seminarvorträge geplant, d.h. einerseits Vortrag, andererseits als Seminar mit Diskussion, Rundgespräch und Fallbeispielen. Eine rege Beteiligung des Publikums an der Erarbeitung eines Themas ist erwünscht.
Die Seminarvorträge beginnen jeweils um 17 Uhr.
Dienstag, 4.9.2018: Flucht und Vertreibung in den letzten Jahrzehnten
Dienstag, 18.9.2018: Macht der Medien
Dienstag, 2.10.2018: Moderne Altenbetreuung: Demenz und Diabetes
Dienstag, 16.10.2018: Demokratie und Verantwortung
Dienstag, 30.10.2018: Moderne Altenbetreuung: Wann geht es in das Heim?
Die Vernissage zur Ausstellung "Heimat und Fremde" findet am Donnerstag, 18.10.2018, um 19 Uhr in der Evangelischen Auferstehungskirche, Innsbruck, Gutshofweg 8, statt.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, Kostenbeiträge (Spenden) sind erbeten.
5 Die Alpen im Wandel der Zeit 2024  |  |
5.1 Bäuerliche Kulturlandschaft  |  |
Die Umwandlung in eine bäuerliche Kulturlandschaft hat neben einer sozioökonomischen Bedeutung für die Bergbauern eine biologische in der die Artenvielfalt der Pflanzen- und Tierwelt (vgl. HAID 2005, VIDEK o.J.).
Der alpine Raum stellt eines der Biodiversitätszentren Europas dar.
Obwohl der alpine Raum nur zwei Prozent der Fläche Europas bedeckt, beherbergt er rund 40 Prozent der europäischen Pflanzenwelt mit rund 400 Pflanzenarten (vgl. BÄTZING 2018, 62-65).
Von besonderer Bedeutung ist der Wald in den Alpen (vgl. geschlossene Waldflächen, Bannwald, Waldweide).
Ebenso gilt der alpine Raum als eine Zone für Wasserreserven (vgl. BÄTZING 2018, 58-61, 164-167).
In den Alpen gibt es mindestens 30 000 Tierarten.
Der Klimawandel setzt dieser Vielfalt besonders zu.
5.2. Almwirtschaft  |  |
Der alpine Raum gilt als ideale Fläche für die Almwirtschaft (vgl. MAIR 2019, 5; Klimawandel wirkt sich auf Almen aus >  https://tirol.orf.at/news/stories/2976847 [20.4.20019], "Dokumentation am Feiertag" Kuh, Schaf, Wolf & Klima > https://tirol.orf.at/news/stories/2976847 [20.4.20019], "Dokumentation am Feiertag" Kuh, Schaf, Wolf & Klima >  https://tirol.orf.at/tv/stories/3168228/ 13.8. 2022]). https://tirol.orf.at/tv/stories/3168228/ 13.8. 2022]).
Die unterschiedliche Nutzung von Nieder-, Mittel- und Hochalmen ist für die bergbäuerliche Bewirtschaftung wesentlich.
Ebenso bedeutend sind die unterschiedlichen Formen von Rinder-, Stier-, Pferde-, Schaf- und Ziegenalmen.
Wesentlich sind die Besitzverhältnisse wie Privat-, Genossenschafts-, Servituts- und Gemeindealmen.
Die Bauweisen unterscheiden Almhütten als Stein- und Holzbauten.
Für das Almpersonal ist "Kost" (Ernährung), Kleidung, Tracht, Entlohnung und Almleben wesentlich.
Die Almen gelten seit ihrer wirtschaftlichen Nutzung auch als Kulturraum (vgl. Feste, Lieder und Almsagen - Erholungsraum).
Die Universität Innsbruck erforscht im Projekt Stella hydrologische Verhältnisse im Tiroler Brixental im Almbereich (vgl.  https://www.uibk.ac.at/geographie/stella/stella-executive-summary.pdf > Version 2/6.11.2017 [21.12.2018]). https://www.uibk.ac.at/geographie/stella/stella-executive-summary.pdf > Version 2/6.11.2017 [21.12.2018]).
Unterschiedliche Aspekte bei Nutzung ergeben aus dem Interessenskonflikt von Ökonomie und Ökologie.
5.3 Alpenraum als Rohstoffquellen  |  |
Der alpine Raum war schon früh ein Gebiet für begehrte Rohstoffquellen, etwa Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Salz (vgl. BÄTZING 2015).
Die Bergbaugebiete wurden zu Handelsknotenpunkten und entwickelten sich in der Folge zu Märkten und Städten (vgl. BÄTZING 2018, 116-123).
Mit der zunehmenden Besiedelung kam es zu Entwicklungen von Wanderbewegungen notwendiger Arbeitskräfte und kulturell und religiöser Vielfalt (man denke an die Reformationszeit mit der Verbreitung des reformatorischen Glaubens durch Zuwanderung in den Bergbauregionen/ Beispiel Schwaz; vgl. BÄTZING 2018, 124-127).
Wirtschaftliche Konzentration und in der Folge damit verbunden politische Macht ergaben sich aus den Gewinnen der Nutzung der Bergbauproduktion.
5.4 Industrielle Revolution  |  |
Mit Beginn der industriellen Revolution begannen die Städte das Land bzw. den alpinen Raum zu beherrschen.
Kleinbetriebe verloren an Bedeutung.
Es begann die Nutzung der große Alpentäler.
Das Auto, der Lastkraftwagen und die neuen Eisenbahnlinien, mit Tunnelbauten im Gebirge, gewannen in der Folge an Bedeutung und wurden zunehmend notwendig.
Heute führen die großen Transversalen von Nord nach Süd durch den Alpenraum und verursachen ökologische Probleme, deren Folgen den Lebensraum und die Lebensbedingungen der Bevölkerung belasten (vgl. die Verkehrserschließung des alpinen Raumes BÄTZING 2018, 132-139).
5.5 Erschließung des alpinen Raumes  |  |
Die Erschließung des alpinen Raumes war die Grundlage für einen Massentourismus, der zu Beginn des von vorigen Jahrhunderts sich entwickelte (vgl. BÄTZING 2018, 150-159).
In vielen Tälern war der Tourismus die Grundlage für eine Besiedelung und einen wirtschaftlichen Nutzen.
Alpine urbane Zentren und Tourismuszentren wurden bzw. werden in diesem Entwicklungsstadium intensiv genützt (vgl. BÄTZING 2018, 160-163).
Problembereiche gibt es, wenn der Tourismus in Gebiete vorstößt, die für keine Besiedelung geeignet sind.
Fragen treten bei der Gestaltung des Tourismus mit Millionen Gästen auf, wenn Erlebnislandschaften in einem sensiblen Raum verlangt und geplant werden.
Der Nutzen für einen Großteil der Bevölkerung ist fraglich (vgl. überdimensionale Infrastrukturen, hoher Strom- und Wasserverbrauch, hohe Müllkapazitäten, teure Baugründe, Verkehrschaos)
Gefordert sind Steuerungsmechanismen, um Raumordnungspläne und regionale Entwicklungen abstimmen zu können.
5.6 Freizeitverhalten  |  |
In diesem Zusammenhang ist etwa das zunehmende Freizeitverhalten der Bevölkerung im alpinen Raum zu sehen (vgl. BÄTZING 2018, 24-27).
Der Drang, die alpine Landschaft zu genießen, bringt für das Wild - man denke allein in Tirol gibt es rund einen Bestand von 200 000 Tieren - in Unruhe, damit können die notwendigen Abschusszahlen jährlich nicht erfüllt werden.
Es bedarf funktionierender Steuerungsmachanismen zwischen der Jägerschaft und den Tourismusverbänden (vgl.  https://tirol.orf.at/news/stories/2953841/ [18.12.2018]). https://tirol.orf.at/news/stories/2953841/ [18.12.2018]).
Im Wintertourismus steigt der Druck durch den Klimawandel.
Gebiete sollen erschlossen werden, die bis jetzt Rückzugsräume waren (vgl. Freizeitparks im Hochgebirge BÄTZING 2018, 194-205).
Heute bildet der alpine Raum das Ziel von rund 120 Millionen Gästen.
Zu beachten sind Bemühungen um einen Naturschutz als Erhaltung der Realität im alpinen Raum (vgl. BÄTZING 2018, 168-169).
Die Erhaltung und Förderung von Nationalparks mit Naturbeobachtungen, Vermehrung des biologischen Wissens und einer Erhaltung von geschützten Großräumen verdient vermehrt Beachtung.
5.7 Zukunft Alpenraum - Zielsetzungen  |  |
Zielsetzungen wären in Anlehnung an HAID (2005) und BÄTZING (2018)
1 eine Aufwertung als dezentraler Lebens- und Wirtschaftsraum,
2 in Anbindung an eine Modernisierung Europas die Erhaltung des alpinen Raumes als Freiraums mit eigenständiger Entwicklung,
3 dies bedeutet die Nutzung der wertvollen Ressourcen (etwa regionstypischer Qualitätsprodukte/Viehwirtschaft, Acker- und Obstbau, Holz, Energienutzung),
4 einen Umbau des Tourismus zur Nutzung der Regionalwirtschaft (vgl. Alpintourismus/Bewertung und Wandel >  http://m.bpb.de/apuz/25886/alpentourismus-bewertung-und-wandel?p=all [2.2.2019]), http://m.bpb.de/apuz/25886/alpentourismus-bewertung-und-wandel?p=all [2.2.2019]),
5 schnelleres Internet mit dezentralen Arbeitsplätzen,
6 neue Kulturlandschaften mit Schutz des Lebensraumes. Dazu bedarf es einer spezifischen Infrastruktur und Stützung, Betreuung und Beratung von Gemeinwesenprojekten,
7 den Ausbau von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen,
8 Versorgung mit Medizineinrichtungen und Krankenbetreuung,
9 Sozialbetreuung für Jugend und Senioren,
10 ausreichender Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr und einen tauglichen Verkehrsverbund,
11 ausreichende Verwaltungseinheiten,
12 Möglichkeiten von Arbeitsräumen,
13 Stützung und Förderung Berglandwirtschaft,
14 Schaffung von Freizeiträumen und
15 die vermehrte Beachtung der Bedeutung der Alpenkonvention zur Wahrung europäischer Interessen an den Alpen ist einzumahnen (vgl. Transitverkehr, Wassernutzung, Erholungsraum/ Schutzräume - Naturschutz - Nationalparks).
5.8 Minderheit in Tirol - Protestanten  |  |
"Das Aufkommen von Reformation und Protestantismus in Tirol war keine ruhige Angelegenheit. Im Gegenteil, die reformatorischen Ideen regten sich sofort und unmittelbar nach dem Öffentlichwerden von Luthers Kirchenkritik, sie äußerten sich zugleich mit dem Erscheinen seiner und der anderen Reformatoren Hauptschriften, die damals Mitteleuropa mit ihren Reformideen lawinenartig überschwemmten. Selbst im europäischen Vergleich traten die reformatorischen Gedanken sehr früh und mit besonderer Heftigkeit auf. Es ist zwar kaum einer breiten Öffentlichkeit bekannt, aber es ist eine Tatsache: Tirol stellt darin eines der interessantesten Gebiete der frühen Reformation im damaligen Europa dar - wie dies auch jetzt die neue schöne Kirchengschichte Tirols von Josef Gelmi zu Recht darlegt (LEEB 2001, 227, GELMI 2001, 135).
Bei aller Frömmigkeit gab es in der Kirche strukturelle Schwächen. Zahlreiche Klagen belegten dies. Die Kirche als Mittlerin des Heils war unglaubwürdig geworden. Ablasswesen, Reliquienkult, Dispens, Privilegien und Wallfahrten ließen Gläubige Missstände im Klerus erleben. Zuverdienste waren Geistlichen oftmals wichtiger als seelsorgerliches Wirken ("Mehr Wirt als Hirt"). Es entstand ein regelrechter Hass auf den Klerus (vgl. GOERZ 1995).
5.9 Evangelische Bewegung im 16. Jahrhundert - Täufertum  |  |
Es überrascht keineswegs, dass vor diesem Hintergrund der erste reformatorische Prediger von Hall Jakob Strauß 1522 großes Aufsehen verursachte und Zulauf gewann. Strauß war kein Einzelfall. Luthers Reformvorschläge Vorschläge waren mit den Gedanken des allgemeinen Priestertums (Gleichberechtigung im geistlichen Sinne und Selbstregelung kirchlicher Angelegenheiten) und der Außerkraftsetzung der Leistungsfrömmigkeit (Gnade als Geschenk Gottes ohne Bezahlung) in Verbindung mit einem kirchenkritischen Biblizismus attraktiv geworden (vgl.im Folgenden DICHATSCHEK 2007, 7-11).
Es entstand in Tirol - insbesondere in den internationalen Zentren des Bergbaues - Schwaz, Hall und Rattenberg - spontan eine evangelische Bewegung von unten aus der Bevölkerung heraus. Allerdings wurden im Unterschied zu anderen österreichischen Ländern diese reformatorischen Aktivitäten von Beginn an entschlossen bekämpft.
"Tirol war als Zentrum des Bergbaues aus finanzpolitischen Gründen so wichtig, dass jede Regelung in den dem Landesherren unterstehenden Städten unterdrückt wurde. Zudem besaß der Tiroler Adel im Vergleich zu den Städten in den anderen habsburgischen Ländern keine vergleichbaren Machtpositionen, sodass sich auch hier kein nachhaltiger politischer Rückhalt für die evangelische Bewegung bilden konnte" (LEEB 2001, 228).
Auf Grund der repressiven Maßnahmen darf man vermuten, dass der radikale Flügel der Reformation in Tirol gestärkt wurde. In diesem Umfeld einer sozial und religiös aufständischen Bewegung, in Verbindung mit Bauernaufständen, entstand die Täuferbewegung. Die abgeschlossenen Täler waren ein europäisches Zentrum von Täufern, wobei das Tiroler Täufertum eine pazifistische Haltung einnahm (vgl. MECENSEFFY 1975, 20). Hunderte männliche und weibliche Täufer wurden grausam verfolgt -verbrannt, gehenkt, enthauptet und ertränkt. Es gab Massenhinrichtungen. Ergreifende Geschichten solcher Hinrichtungen sind dokumentiert (vgl. MECENSEFFY 1975, 21). Als in Kitzbühel zwei Täufer hingerichtet werden sollten, rief jemand aus der Menge. "Ei wie fein lassen eure Hirten und Lehrer das Leben für euch" (zur Stärke des Luthertums im Raum Kitzbühel LEEB-LIEBERMANN-SCHEIBELREITER-TROPPER? 2003, 215).
Heimliche Auswanderungen bis nach Mähren in die Nähe von Nikolsburg begannen. Der Pustertaler Jakob Huter ("Hutter") wurde Führer jener Gruppe, die später als Hutterer bezeichnet wurden. Bei seiner Rückkehr in die Heimat wurde Huter festgenommen und 1536 in Innsbruck verbrannt. Über Zwischenstationen in Siebenbürgen, der Walachei und der Ukraine kamen die Hutterer 1874 bis nach Amerika ("Hutterian Brethern Church"). In South Dakota gründete man den ersten "Bruderhof". Diese "Brüderhöfe" - Zeichen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Gütergemeinschaft - mit Abgrenzungen zu bestehenden Gemeinschaft, bestehen heute noch. Manche Bewohner sprechen neben Englisch noch jetzt ein altertümliches Deutsch mit Tiroler und Kärntner Einschlag (vgl. LEEB - LIEBMANN - SCHEIBELREITER - TROPPER 2003, 191
 -192; SCHLACHTA 2006; Verordnungsblatt des Landesschulrats für Tirol/ Jg. 2006, Stück X, Nr. 75 "Symposium und Seminar 'Verbrannte Visionen' -Jakob Hutter und die Täuferbewegung"). -192; SCHLACHTA 2006; Verordnungsblatt des Landesschulrats für Tirol/ Jg. 2006, Stück X, Nr. 75 "Symposium und Seminar 'Verbrannte Visionen' -Jakob Hutter und die Täuferbewegung").
5.10 Geheimprotestantismus  |  |
Wie man heute weiß, wurde kein Lutheraner in Tirol aus Glaubensgründen hingerichtet. Nur ein kleiner Teil schloss sich der Täuferbewegung an. Trotz massiver Verfolgung entstand die für Tirol typische Situation, "dass es zwar zahlreiche evangelische Personen gab, die manche Regionen sogar dominierten, dass diese aber inoffiziell existierten" ( LEEB 2001, 229). Das Schicksal von Jakob Stainer, dem berühmten Geigenbauer aus Absam, ist ein typisches Beispiel hierfür. Als Anhänger Luthers geriet er in Konflikt mit der katholischen Kirche, die ihn nach einem kostspieligen Prozess über sechs Monate einsperrte.
1549 hört man von Klagen, dass in Gehöften und Häusern zur Zeit der katholischen Sonntagsmesse evangelische Gottesdienste bzw. Andachten vom Hausvater der Familie mit dem Gesinde bzw. den Nachbarn mit Bibelauslegung, Gebet und Liedern gehalten wurden. In Wohnstuben wurde ein Tisch als Altar aufgestellt. Im Gegensatz zu Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten - wo der Protestantismus legitimiert wurde - gab es in Tirol keine Kirchenorganisation und Prediger, so dass man hier von einem Laienchristentum sprechen kann.
"Es ist der evangelischen Geschichtsschreibung kaum bzw. gar nicht bewusst, dass zuerst in Tirol (und dann in Salzburg) auf diese Weise schon sehr früh das bemerkenswerte kirchengeschichtliche Phänomen des so genannten Geheimprotestantismus entstand. Nicht immer war es so geheim, wie es der Name es suggeriert. Es äußerte sich oft auch als Aufmüpfigkeit, wenn z.B. in den Wirtshäusern auf provokante Weise lutherische Schandlieder gesungen wurden (es existierte während der Gegenreformation ein bestimmtes Sortiment an lutherischen Kampfliedern). Bei Vorladungen zeigte sich ein ziviler Ungehorsam, man berief sich auf die Gewissensfreiheit, man müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen" (LEEB 2001, 229). Insofern kann man in Tirol auch von einem politischen Protestantismus im 16. Jahrhundert sprechen.
5.11 Ausweisungen und Emigration  |  |
Seit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 bestimmte der Landesherr die Konfession in seinem Land (ursprünglich "ubi unus dominus, ibi una sit religio"). Folgte man dieser Regelung nicht, konnte/ musste man auswandern. Gegenüber dem mittelalterlichen Ketzerrecht wurde dies als Fortschritt angesehen, zumal man mit Vermögen und in Ehren das Land verlassen konnte. Dieses Recht gilt als Grundrecht von Untertanen in Europa (vgl. HECKEL 1983, 33)
Für Tirol gilt, dass bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts evangelisches Leben noch nachzuweisen ist. Zwei Ausnahmen, die allerdings damals teilweise zu Salzburg gehörten, bilden das Defereggen- und das Zillertal. Auf der Grundlage des Augsburger Religionsfriedens 1555 und der Bestimmungen des Westfälischen Friedens 1648 wurden evangelische Deferegger ab 1684 ausgewiesen. Mit der Missionierung durch Kapuzinerpatres begann sich die Situation in Form von antiklerikalen Aktionen zu verschärfen. Bei der Auseisung durch den Salzburger Erzbischof Max Gandolf von Kuenberg kam es zur Verletzung der Durchführungsbestimmungen. Es wurden keine Dreijahresfrist zur Vorbereitung der Emigration eingehalten, vielmehr mussten 621 Personen um Neujahr innerhalb weniger Wochen das Tal verlassen. Das Corpus Evangelicorum in Regenburg zur Einhaltung der Reichsverfassung wurde zu spät informiert, womit nur eine bruchstückhafte Wiedergutmachung der Bestimmungen möglich wurde (vgl. DISSERTORI 1964).
Die Ausweisung evangelischer Zillertaler 1837 steht in Verbindung mit der Rechtsgültigkeit des Toleranzpatents von 1781, das für Tirol auch galt. Als nämlich 1826 drei evangelische Hippacher aus der katholischen Kirche austraten, kam eine Austrittsbewegung mit letztlich 427 Personen in Gang (vgl. HEIM-REITER-WEIDINGER? 2006; KÜHNERT 1973, 15). Der Tiroler Landtag stimmte mehrheitlich für konfessionelle Einheit des Landes. Die letzte Entscheidung hatte Kaiser Ferdinand, der die Ausweisung trotz Gültigkeit des Toleranzpatents verfügte, die internationales Aufsehen erregte.
Nach dem Bekenntnis zur freien Religionsausübung in der Unabhängigkeitserklärung der USA (1776) und der Französischen Revolution (1789) war das Toleranzpatent 1781 mit Einschränkungen versehen, wodurch Ideen der Aufklärung - religiöse Toleranz und Gleichberechtigung - unterlaufen wurden und die Ausweisungen ein unzeitgemäßes Relikt und als solches ein Spezifikum der Tiroler Geschichte darstellten (vgl. RIEDMANN 1982, 115; LEEB 2001, 231).
5.12 Protestantenpatent 1861  |  |
Damit war in Tirol keineswegs die Gründung einer evangelischen Gemeinde möglich. Meran als Kurort hatte zwar gleich einen Betsaal für die vielen evangelischen Gäste eingerichtet, eine Gründung einer Pfarrgemeinde war dies nicht. Die Mehrheit des Tiroler Landtages beschloss in der Folge ein Gesetz, wonach die Bildung einer evangelischen Gemeinde verboten sei. Wien bestätigte dieses Gesetz nicht. 1863 verabschiedete der Landtag daraufhin ein Gesetz über die Zulassung einer privaten Religionsausübung.
Für diese politische Bewegung sprach der Brixner Fürstbischof Vinzenz Gasser von der Einheit des Glaubens als kostbarem Edelstein im Ehrenkranz Tirols (vgl. GELMI 2001; LEEB 2001, 231). Die gesteigerte Frömmigkeit in Europa zeigte sich in Tirol im Herz - Jesu - Kult. Der gefühlsmäßige Widerstand gegen evangelische Gemeindegründungen hat hier seine Wurzeln.
Einer der Wortführer einer liberalen Gruppe in Tirol war der Jenbacher Gastwirt und Arzt Norbert Pfretschner, der als Reichstagsabgeordneter noch in seiner Jugend die Ausweisung der Zillertaler erlebt hatte. Demonstrativ gab er seinem Gasthaus den Namen "Zur Toleranz".
Die Reichsverfassung 1867 brachte erst einen Durchbruch mit den Gemeindegründungen 1876 von Meran und Innsbruck, den ersten öffentlich anerkannten evangelischen Pfarrgemeinden in der Geschichte Tirols. Mit dem Verlust der Glaubenseinheit des Landes reichte auch Fürstbischof Vinzenz Gasser seinen Rücktritt bei Papst Pius IX. ein, der ihn jedoch zum Weitermachen ermunterte, da in Rom sich inzwischen auch eine evangelische Gemeinde konstituiert hatte. 1883 war es auch im Tiroler Landtag nicht mehr möglich, das Protestantenpatent zu kippen.
5.13 Nachkriegszeit - Gegenwart  |  |
Nach einer massiven Austrittswelle 1938 musste 1945 und danach durch die Flüchtlingsströme, in der Folge durch Aussiedler und später Urlaubsgäste evangelisches Leben und Kirchenorganisation neu gestaltet werden. Gottesdienste in kirchenfremden Räumlichkeiten und Neubau von Kirchen und Gemeindezentren mit Gründung von Pfarrgemeinden als Körperschaften öffentlichen Rechts sowie der die Versorgung mit Religionsunterricht waren wesentliche Aufgabenfelder (vgl. Protestantengesetz 1961: "freie Kirche in einem freien Staat").
Gleichzeitig versuchte in der unmittelbaren Nachkriegszeit die "Innere Mission", später Diakonie, die Sicherstellung der alltäglichen Lebensbedürfnisse über die Pfarr- und Tochtergemeinden sowie Predigtstationen zu gewährleisten.
Kennzeichnend für die Evangelische Kirche, nicht nur in Tirol, war eine zunächst betont unpolitische Haltung. Diese hat sich inzwischen mit Beschlüssen der Generalsynoden in den letzten Jahrzehnten geändert. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang besonders an das ausdrückliche Bekenntnis zur Demokratie und zur Europäischen Union als Friedensgemeinschaft sowie der Mitarbeit in internationalen kirchlichen Organisationen wie dem Lutherischen Weltbund, Weltkirchenrat/ WCC, der Gemeinschaft Evangelischen Kirchen Europas/ GEKE und der Ökumene. Themen wie Armut, Migrantentum und Bildungsfragen spielen in der Aufgabenstellung ebenso eine Rolle.
Für Tirol ist auch zu vermerken, dass sich das Verhältnis der Konfessionen zueinander grundsätzlich geändert hat. Erfahrungen des Krieges und der NS - Zeit brachten eine Wende, auch die zunehmende Säkularisierung und die großen Tourismusströme spielten eine Rolle. Auf offizieller Ebene war das II. Vatikanische Konzil entscheidend. Nur so war etwa die Versöhnungsfeier im Defereggental 2002 möglich.
Innerkirchlich vertreten die sieben Tiroler Pfarrgemeinden - Innsbruck-West? und -Ost, Oberinntal, Reutte, Jenbach, Kufstein und Kitzbühel - in ihren kirchlichen Gremien die Interessen evangelischer Christen über die Pfarrgemeinden hinaus in der Diözese Salzburg - Tirol und in den Kommissionen, Ausschüssen und Leitungsgremien der Gesamtkirche. Ein besonderes Problem stellt die unzureichende Zahl ehrenamtlicher Mitarbeiter dar (vgl. DICHATSCHEK 2005, 14). Entsprechende zusätzliche Angebote zur Schulung sind notwendig.
1966 wurde die selbständige Diözese Salzbug-Tirol? gegründet. 2004 wurde das "Evangelische Bildungswerk in Tirol" reaktiviert und bedarf eines zunehmenden Engagements. 2005 übersiedelte, kirchengeschichtlich einmalig, die Superintendentur von Salzburg nach Innsbruck. 2006 konnte ein "Offenes Evangelisches Kirchnzentrum" in Innsbruck (Christuskirche) eröffnet werden. Mit diesen Aktivitäten wurden Akzente evangelischen Glaubenlebens über Jahre hinweg gesetzt.
Theaterstücke
Karl Schönherr (1867-1943): Glaube und Heimat. Tragödie eines Volkes (1910)
Felix Mitterer (1948): Verlorene Heimat - Stumm: Zillertaler Volksschspiele 1987
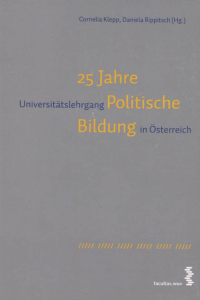
Cornelia Klepp - Daniela Rippitsch (Hrsg.): 25 Jahre Universitätslehrgang Politische Bildung in Österreich / Politische Bildung in Schloss Hofen - Rückblick, Rundblick und Ausblick eines Teilnehmers, 133-136, Fakultas Verlag 2008,  ISBN 370890267X ISBN 370890267X
Im Jubiläumsjahr 2007 "20 Jahre Politische Bildung - Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung Schloss Hofen" besucht der Autor den 10. Universitätslehrgang Politische Bildung 2006-2008, der 1987 - zunächst als Hochschullehrgang - von der Universität Salzburg in Verbindung mit dem Land Vorarlberg in der Verwaltungsakademie des Landes Vorarlberg in Lochau eingerichtet wurde.
Als Teilnehmer von drei vorgeschriebenen Zusatzseminaren zum Masterprogramm des Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universitäten Klagenfurt/ Donau - Universität Krems erlebt man eine beeindruckende Vielfältigkeit in Angebot und Lehre, die den Fachbereich Politische Bildung spannend, abwechslungsreich und zudem als Nicht - Vorarlberger in einer "anderen" Variante erscheinen lässt. Dies soll zunächst kurz dargestellt werden.
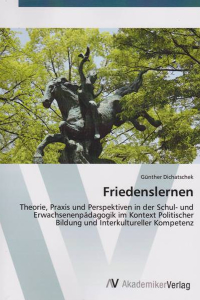
Friedenslernen - Theorie, Praxis und Perspektiven in der Schul--und Erwachsenenpädagogik im Kontext Politischer Bildung und Interkultureller Kompetenz, Akademiker Verlag Saarbrücken 2022,  ISBN 620220446X ISBN 620220446X
Die Thematik setzt sich als Schlussarbeit des Fernlehrganges 2019/2020 "Nachhaltige Entwicklung" der Evangelischen Arbeitsstelle Fernstudium im Comenius - Institut Münster mit dem Bildungsansatz "Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) " auseinander. Es handelt sich um ein Lern- und Handlungsfeld, das 1992 in der Folge der Rio-Konferenz? entstand. Die Arbeit bezieht sich als Basis auf den Teilbereich Friedenslernen bzw. Friedenserziehung und Friedensforschung. Dem Autor liegt dieser Schwerpunkt als Beitrag zur Politischen Bildung Demokratieerziehung und Interkultureller Bildung durch seine Tätigkeit in der Lehrerbildung bzw. Erwachsenenpädagogik. Der Wandel zur einer nachhaltigen Welt erfordert ein Umdenken der gesamtgesellschaftlichen und politischen Verantwortung. Bildungsbereiche erhalten pädagogische Aufgabenstellungen.
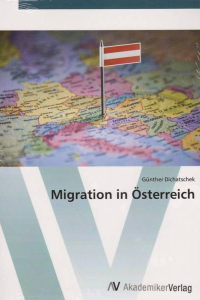
Migration in Österreich, Akademiker Verlag Saarbrücken 2020,  ISBN 620067096X ISBN 620067096X
Eine Migration ohne moralische Vorurteile kommt zu ökonomischen und sozialer Aspekten zu tragfähigen Schlussfolgerungen. Eine mäßige Einwanderung ökonomisch überwiegend günstige und soziale zweideutige Folgen für die einheimische Bevölkerung. Kulturelle Vielfalt steht gegenseitiger Rücksichtnahme und Schwächung des Sozialsystems durch Auslandsgemeinden gegenüber. Eine massive Einwanderung hat nachteilige ökonomische und soziale Folgen. Öffentliches Kapital muss aufgeteilt werden.
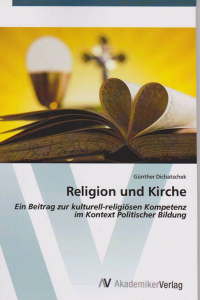
Religion und Kirche - Ein Beitrag zur kulturell - religiösen Kompetenz im Kontext Politischer Bildung, Akademiker Verlag Saarbrücken 2021,  ISBN 333050501X ISBN 333050501X
Das vielfältige Verhältnis von Religion und Politik bildet für die Politische Bildung einen Aufgabenbereich, der die Rahmenbedingungen für eine kulturell-religiöse Praxis und Konfliktlösungen untersucht. Zu betrachten sind Formen der Verbindungen bzw. Trennung von Religion und Staat. Ein Basiswissen erscheint auf dem Hintergrund eines zunehmend geringen religiösen Sachwissens wesentlich.
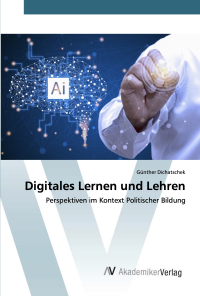
Digitales Lernen und Lehren - Perspektiven im Kontext Politischer Bildung, Akademiker Verlag Saarbrücken 2023,  ISBN 3639498623 ISBN 3639498623
Die Studie zu Themen des Lehrens und Lernens mit Technologien hat ihre Grundlage in der Bedeutung der verschiedenen Anwendungen, Perspektiven und Technologien. Der Einsatz erfordert eine neue Auseinandersetzung mit dem Fachgebiet und einen interdisziplinären Ansatz. Hilfreich sind Online - Kurse/ TU Graz und CONEDU und ein Einstieg in die Netzwerkarbeit. Die Überlegungen verstehen sich als Einstieg in ein weites Themenfeld.
Zum Autor  |  |
APS - Lehramt (VS - HS - PL 1970, 1975, 1976), zertifizierter Schülerberater (1975) und Schulentwicklungsberater (1999), Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für die APS beim Landesschulrat für Tirol (1993-2002)
Absolvent Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft Ursprung - Klessheim/ Reifeprüfung, Maturantenlehrgang der Lehrerbildungsanstalt Innsbruck/ Reifeprüfung - Studium Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), 1. Lehrgang Ökumene - Kardinal König Akademie/ Wien/ Zertifizierung (2006); 10. Universitätslehrgang Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ MSc (2008), Weiterbildungsakademie Österreich/ Wien/ Diplome (2010), 6. Universitätslehrgang Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012), 4. Interner Lehrgang Hochschuldidaktik/ Universität Salzburg/ Zertifizierung (2016) - Fernstudium Grundkurs Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2018), Fernstudium Nachhaltige Entwicklung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium, Comenius - Institut Münster/ Zertifizierung (2020)
Lehrbeauftragter Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft/ Universität Wien/ Berufspädagogik - Vorberufliche Bildung VO - SE (1990-2011), Fachbereich Geschichte/ Universität Salzburg/ Lehramt Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung - SE Didaktik der Politischen Bildung (2026-2017)
Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche Österreich (2000-2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks Tirol (2004 - 2009, 2017 - 2019) - Kursleiter der VHSn Salzburg Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg/ "Freude an Bildung" - Politische Bildung (2012 - 2019), VHS Tirol/ Grundkurs Politische Bildung (2024) und Evangelisches Bildungswerk Salzburg - Tirol/ Die Alpen im Wandel der Zeit (2024)
 MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net
|