|
Kindheit
Grundwissen Kinderbildung  |  |
Aspekte einer Theorie, Praxis und Handlungsfelder im Kontext der Erziehungs- und Familienwissenschaft  |  |
Günther Dichatschek
 | | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |
|
|
Vorbemerkung  |  |
Die Thematik beruht auf schulischer Lehrtätigkeit in Unterricht (APS), Elternberatung und Lehrerbildung. Vielfältige Aspekte ergeben ein Wissen und Handlungsfelder.
Die Studie beansprucht keine Vollständigkeit, sie dient dem Versuch einer persönlichen Zusammenfassung und der Perspektive einer grundlegenden Lebensphase. Eine besondere Bedeutung erhält die spezifische Fachliteratur.
Einleitung  |  |
Die Erkenntnisse einer modernen Kinderbildung in dieser Studie stellen das Kind als Subjekt einer Gesellschaft, dass sich die Umwelt aneignet und ein Leben in der Gegenwart wünscht, als Akteur in den Mittelpunkt (vgl. zur Einführung BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, NEUSS-KÄHLER? 2022).
Kinder benötigen den Erwerb sozialer, motorischer, kognitiver und affektiver Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie erschließen die Umwelt und verändern sie mit ihren Wünschen, Interessen und Bedürfnissen.
Es ist davon auszugehen, dass sie mit ihrer individuellen Entwicklung noch nicht fertig sind und mit der einmaligen Persönlichkeit und Kompetenzen zu beachten und zu behandeln sind.
Die meisten Kinder können heute bei uns die Vorteile einer Wohlfahrtsgesellschaft in Anspruch nehmen, spüren aber auch Nachteile einer modernen Lebensweise für die Formen der Industrialisierung, Urbanisierung, Ökonomisierung und Individualisierung im Alltagsleben. Es kommt zu körperlichen, seelischen und sozialen Belastungen bereits in der Kindheit.
Es geht um den Erwerb von Urvertrauen, die Beziehung zu den Eltern, die Einstellung zum eigenen Körper, den Aufbau kognitiver Konzepte und eigenem Denken, eine Entwicklung von Gewissen und Moral sowie Beziehungen zu Gleichaltrigen.
Kinder sind handlungsaktiv, aber nicht handlungsautonom, benötigen daher Hilfe und Unterstützung. Eine Minderheit erlebt kein Verständnis und Hilfestellungen, leidet unter Benachteiligungen und wirtschaftlicher und sozialer Not.
I Erziehungwissenschaft  |  |
1.1 Historische Aspekte  |  |
1 Im Mittelalter gibt es keinen Begriff der Kindheit als eine eigenständige Lebensphase in der Biographie. Kind wird als Verwandtschaftsverhältnis, aber nicht als Altersangabe verwendet. So wird das Kind im Frühmittelalter als "kleiner Erwachsener" angesehen, das mit "großen Erwachsenen" in der Familie lebt (vgl. ARIES 1978/2007). Kinder leben in der gleichen Lebenswelt, demnach einer einheitlichen Tagesorganisation, verrichten fast dieselben Tätigkeiten und haben ähnliche Sozialkontakte, ernähren und kleiden sich ähnlich.
Eine Abgrenzung von der Erwachsenenphase gab es nicht. Die kollektive Lebensform ließ keinen Raum für eine Privatheit und Intimität zu, die Familie erfüllte nur eine praktische Funktion mit der Bewältigung des Alltages und der Erhaltung des Besitztums.
2 Eine Veränderung zur Einstellung zu Kindern erfolgte langsam erst im Spätmittelalter. Mütter, Ammen und Kinderfrauen nahmen sich Zeit für Kinder. Der Einfluss von Kirche, Moralisten und Humanisten entstand allmählich (vgl. Erasmus von Rotterdam). Es entstand ein Verlangen nach Formen und einer Art des Bildens/ Erziehens, etwa guter Manieren, vorrangig der männlichen Kinder (vgl. ARIES 1978, 560-562).
3 Ungefähr um das 14. Jahrhundert entsteht der Begriff "Kindheit" mit der Idee von Erziehung und Bildung nur sehr langsam. Mit der Durchsetzung bildet sich die Institution "Schule", Kinder als noch nicht erwachsen mit besonderen Verhaltensansprüchen zu sehen. Diese Ansprüche gelten den Kindern bürgerlicher Familien.
4 Im Gegensatz bis zum 19. Jahrhundert stand das Verhalten gegenüber Kindern aus armen Familien, die wie Erwachsene arbeiten mussten/ Arbeitskraft, Krankheit, Elend (vgl. die sozialen Bedingungen in der Agrargesellschaft, im Handel, Gewerbe und Manufakturen).
5 Mit dem Gedanken der allgemeinen Schulpflicht im 19. Jahrhundert (1869/ Österreich "Reichsvolksschulgesetz") bis zur Beendigung der Schulpflicht kommt der Rückgang der Kinderarbeit. der Entwicklungsprozess führt zu einem allgemeinen Schulwesen und in der Folge zur Trennung von Bildung und Ausbildung. Für Kinder entstehen eigene Lebensräume.
6 Mit Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts kommt es zu einer industriellen und demokratischen Massengesellschaft mit der Ausweitung von Schule und Kindergarten neben der Familie. Erst jetzt setzt sich die Vorstellung von Erziehung, Persönlichkeit und letztlich einer Bedeutung des Kindes durch.
Historischer Verlauf vom Wandel der Kindheit
 | | Epoche | Persönlichkeit des Kindes | Erziehung des Kindes |
| Frühes Mittelalter | keine Trennung von Erwachsenen | Lehrverhältnis Erwachsener - Kind |
| Spätes Mittelalter | Anerkennung kindlichen Wesens | Interesse an Erziehung und Bildung |
| Industrielles Zeitalter | Bildung und Ausbildung
Kinderarbeit | Kind Eigentum der Eltern |
| Heutige Zeit | kindliche Individualität | Sozialisation Kindergarten - Schule |
|
|
Quelle:
BRÜNDEL - HURRELMANN 1996, 19
1.2 Veränderung der Einstellung - Demographie  |  |
In spätmodernen Gesellschaften nahm in den letzten Jahrzehnten die Zahl der jüngeren Menschen ab, die Zahl der älteren Menschen weiter zu. In der Folge kommt es zu einem Rückgang der Geburtenzahl. Der Altersaufbau der Bevölkerung hat sich stark verändert. Prognosen gehen davon aus, dass die Entwicklung so weitergeht.
Der Kinderwunsch verändert sich angesichts von Abwägungen der Zukunftssicherung, auch der medizinischen Erkenntnisse von Verfahren von Verhütungsmethoden. In den Vordergrund treten positive Aspekte eines Kinderwunsches wie persönliche, emotionale und biographische Motive. Mutterschaft wird auch zum Gegenteil der Berufswelt mit Aspekten von Geduld, Fürsorglichkeit, Einfühlungsvermögen, Zärtlichkeit und Nähe.
Damit stellen sich auch Fragen langfristiger Entwicklungen von Lebensplanung und Lebensspielräumen, man denke nur an die zunehmende Bedeutung biographischer Faktoren in der Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft mit ihren Teildisziplinen.
Für viele Eltern verändern sich in vielen Bereichen des Alltags die Lebensgewohnheiten, damit ökonomische und soziale Faktoren. Kinder verursachen und verlangen, im Gegensatz zu vorigen Epochen, besondere Ansprüche und Betreuung in der Gestaltung von praktischen Lebensvollzügen.
Demographische Veränderungen verlangen Maßnahmen in den Teilbereichen der Politik wie der Familienpolitik, Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik und Bildungspolitik (vgl. im Bildungsprozess die zunehmende Bedeutung einer Politische Bildung; DICHATSCHEK 2022).
1 Vor dem Ersten Weltkrieg lag der Anteil der Kinder unter 15 Jahren in der Gesamtbevölkerung ungefähr bei einem Drittel, 1992 betrug er nur noch rund 15 Prozent. Die Altersgruppe der Personen im Rentenalter stieg auf rund 15 Prozent.
2 In den sechziger Jahren beeinflusst Zuwanderung und Abwanderung die Bevölkerungsentwicklung. Damit stieg der Anteil von Kindern durch die höhere Zahl pro zugewanderten Familien. Es zeigt sich in der Folge, dass sich die Geburtenhäufigkeit in der nächsten Generation an die der autochthonen Bevölkerung angleicht.
3 Zunehmend hat die Bevölkerungsgruppe der Kinder (und Heranwachsende) heute es schwer, sich gesellschaftspolitisch in ihrer Bedeutung politisch zu äußern. Es geht etwa um Investitionen in den Bereichen Kindergarten, Schulen, Kinderräumlichkeiten (und Jugendeinrichtungen) und Kindergeld - den Personalmangel der Betreuung und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle.
4 Die Verlängerung der Lebensspanne macht neue soziale und biographische Räume notwendig durch die Tendenz zur Gliederung in einzelne Lebensphasen, damit auch der Kindheit.
Die Kindheitsforschung legt den Beginn der Kindheitsphase mit der Geburt fest. Eine genaue Unterscheidung erfolgt in eine prä- und postnatale Entwicklung des Kindes. Der Begriff "Kindheit" meint einen bestimmten Abschnitt der postnatalen Entwicklung. Es wäre/ ist konsequent, die vorgeburtliche Entwicklung in das Verständnis von Kindheit einzubeziehen (vgl. RAUH 1995, 167-248; die Bedeutung des "Mutter-Kind-Passes?").
In den ersten Lebensjahren sind Kinder von Erwachsenen abhängig und benötigen massiv ihren Schutz, psychische Wertschätzung, Pflege und Versorgung. Auch ein Säugling ist sozial aktiv und wirkt verändernd auf die soziale Umwelt. Trotz der Hilfsbedürftigkeit, vielen Regeln und Ereignisse verfügen sie über Gestaltungskraft und Einflüsse von sozialen Beziehungen (vgl. SCHMIDT-DENTER? 1994).
Kindheitsphasen kann man in Abschnitte gliedern (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 26-27).
- Frühe Kindheit - Säuglingsalter (0-1 Jahre) und Kleinkindalter (1-3 Jahre)
- Späte Kindheit - Vorschulalter (4-5 Jahre) und Grundschulalter (6-11 Jahre)
Unterschieden wird nach den unterschiedlichen körperlichen, seelischen und sozialen Entwicklungen, wobei die Wahrnehmung der Umwelt wesentlich ist. Ein Wandel zeigt sich schon zwischen Vorschulalter und Grundschulalter. Ebenso zeigt sich ein Wandel beim Übergang vom Grundschulalter zum frühen Jugendalter mit fließenden Grenzen (vgl. schulisch der Übergang vom Primarbereich in den Sekundarbereich).
Die Lebensphase Kindheit in spätmodernen Gesellschaften ist von einem dynamischen Wandel geprägt. Betroffen sind das individuelle Aufwachsen, Erziehungsprozesse, Bildungsgänge und Sozialisierungsprozesse (vgl. NEUSS-KÄHLER? 2022, 21).
In dieser Entwicklung liegt auch die Chance, das Gewicht eines Lebensabschnittes besser als bisher zu erkennen. Damit können besser Ansprüche und Rechte von Kindern gesamtgesellschaftlich betont und bestimmt werden. Veränderungsprozesse als Entwicklungsaufgaben können so in soziale Bezugssysteme eingebunden werden (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 27).
1.4 Entwicklungsaufgaben  |  |
In der frühen Kindheit sind die Entwicklungsaufgaben ein Aufbau von Urvertrauen von emotionalen Bindungen, sensomotorischer Intelligenz, vorbegrifflichem Denken, sprachlichem Ausdrucksvermögen und einem Aufbau von sozialem Verhalten.
1 Kennzeichnend sind das Erkunden der gegenständlichen Welt und der Erwerb von ersten Begriffen. Körperkontakt, verbale Impulse, Anregungen durch Gegenstände und Materialien und ein Eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes.
2 In der Kleinkindphase kommt es zur ersten Identifikation mit dem eigenen Geschlecht. Geschlechterrollen besitzen eine kulturelle Prägung. Vater und Mutter sind die ersten Modelle von Männlichkeit und Weiblichkeit. In der Folge kommt es zu anderen sozialen Identifikationen und Bezugspersonen. Die Qualität des Bezugssystems ist Grundlage für spätere sozialen Beziehungen. Zentrale Bezugsperson ist die Mutter. Hier zeigt sich künftig aus der Mutter - Kind -Beziehung die Kontaktsicherheit bzw. Ängstlichkeit oder Zurückhaltung.
4 In der Familie gibt es ein komplexes Netzwerk an Einflüssen in Interaktionsformen, das später auch den Vater und die Geschwister sowie Gleichaltrige aufnimmt. Die Vaterrolle wird für den schulischen Entwicklungsprozess hoch eingeschätzt, besonders in der emotionalen Funktion.
5 Das väterliche Verhalten unterliegt kulturell und damit gesellschaftlicher Veränderung (vgl. FTHENAKIS 1993, 101-105). Väter als Alleinerzieher zeigen, dass es eine intensive Vater - Kind - Beziehung geben kann. Es zeigt sich, dass Väter etwa geringere Disziplinprobleme haben als alleinerziehende Mütter. In der alleinigen Verantwortung zeigen sie oftmals ein breiteres Verhaltensspektrum als in der traditionellen Familie (vgl. BRÜNDEL - HURRELMANN 1996, 29).
6 Ein wichtige Bedingung bildet der väterliche Einfluss für die kognitive, moralische und soziale Entwicklung des Kindes (vgl. SCHMIDT - DENTER 1994, 45-47). In der Familie ergibt sich für jedes Mitglied eine bestimmte Beziehung zum Anderen. Modifiziert werden die Beziehungen durch interndynamische Faktoren zu beiden Elternteilen und den Geschwistern (vgl. OERTER 1993, 78-90).
Im Vorschul- und Grundschulalter sind Entwicklungsaufgaben und der Aufbau von kognitiven Konzepten und Denkschemata, Fertigkeiten in den Kulturtechniken und erste Schritte sozialer Zusammenarbeit mit Gleichaltrigen und Wertvorstellungen zu leisten (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 30-32).
Schule bewirkt, dass Kinder zu Lernenden ("Schülern") werden, demnach neben kognitiven Leistungen auch eine soziale Kompetenz und eine Anpassung an eine institutionelle Umwelt erlernen. Erforderlich sind ein altersgemäßes Arbeits-und Leistungsverhalten bzw. eine personale Motivation. Schule stellt durch Lehrende ("Lehrer") besondere Anforderungen eines sozialen Miteinanders. Eingeübt wird ein soziales Verhalten gegenüber unbekannten und anderen ("fremden") Erwachsenen in Autoritätsstellung.
Erkenntnisse der Lebenslauf- und Sozialisationsforschung weisen auf den lebensbestimmmenden Einfluss der Erlebnisse und Ereignisse auf das spätere Jugend- und Erwachsenenleben in der Kindheit hin (vgl. KOHLI 1991, 303-320; HUININK-GRUNDMANN? 1993, 67-78). Allerdings verlaufen diese Entwicklungsprozesse nicht linear.
Aus der Resilienzforschung weiß man, dass einige Kinder trotz negativer Umwelteinflüsse wie Krankheit, Unfälle oder Verlust der Eltern sich positiv entwickeln können (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1998, 31). Schutzfaktoren wie entlastende soziale Kontakte und Unterstützungserfahrungen verringern die Risikofaktoren und wecken die Widerstandskräfte (Resilienz). Personale Schutzfaktoren wie ein positives Selbstbewusstsein, spontanes Temperament und internale Kontrollüberzeugungen (genau wissen, was man will bzw. kann/ Urteilsfähigkeit), können helfen und beitragen negative Einflüsse aufzufangen (vgl. KOLIP-HURRELMANN-SCHNABEL? 1995). Viele Hinweise ergeben, dass Beeinträchtigungen und schwierige Situationen durchaus kaum oder wenig negative Folgen haben können (vgl. OERTER 1983, FEND 1990).
 | | Abschnitte der Kindheit | Entwicklungsaufgaben | Soziale Beziehungssysteme |
| Frühe Kindheit |
| | Säugling (0-1 Jahr) | Urvertrauen
sensomotorische Intelligenz
emotionale Bindung | überwiegend Mutter |
| | Kleinkind (1-3 Jahre) | Geschlechtszugehörigkeit
sensomotorische Intelligenz
symbolisches Denken | Familie, Mutter, Vater und Geschwister |
| Späte Kindheit |
| | Vorschulkind (4-5 Jahre) | soziale Kooperation
anschauliches Denken | Familie, Gleichaltrige, Kindergarten, Vorschule |
| | Grundschulkind (6-11 Jahre) | Kognitive Konzepte:
Schreiben, Lesen, Rechnen,
begriffliches Denken, Werte | Grundschule, Gleichaltrige, Familie, Erwachsene |
|
|
Quelle: BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 28
1.4.3 Jugendphase  |  |
Die Kindheit, als eigenen Entwicklungsprozess in der Biographie zu verstehen, endet mit der Pubertät mit einem Ungleichgewicht in der psychophysischen Struktur der Persönlichkeit (vgl. FEND 1990, 54-56).
Kennzeichnend ist ein Selbständigkeitsstreben und ein gewisses Bedürfnis nach Unabhängigkeit in der Jugendphase. Eltern und Erwachsene erhalten jetzt eine neue Bedeutung. Abgrenzung, Widerspruch und Rivalität treten auf. Ein Kontrastbild zu Erwachsenen kann auftreten.
Damit zeigt sich eine Trennung beider Entwicklungsprozesse und die Notwendigkeit altersgemäßer pädagogischer Herausforderungen.
2 Theorien  |  |
Eine theoretische Analyse und Erforschung der Kindheit hat in den letzten Jahrzehnten psychologische und soziologische sowie integrative Ansätze ergeben (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 48-86; NEUSS-KÄHLER? 2022, 110-138).
Im Folgenden wird skizziert und verkürzt auf die Theorien eingegangen.
- Zu den psychologischen Theorien gehören die Psychoanalyse, Lerntheorien und die Theorie der kognitiven Entwicklung.
- Zu der soziologischen Theorie zählt die soziale Interaktion.
- Zu den integrativen Theorien zählen die systematisch-ökologische Theorien und die Sozialisationstheorie.
- Eine Zusammenfassung der Kinderbildungstheorien beschließt das Kapitel.
2.1 Psychoanalytische Theorie  |  |
Die Psychoanalyse behandelt den von Siegmund Freud entwickelten psychodynamischen Ansatz, der den Prozess der Subjektwerdung in den Mittelpunkt stellt. Die Subjektwerdung ist eng an den familiären Sozialisierungsprozess gekoppelt, an die Eltern-Kind-Beziehung? mit den Erwartungen, Bedürfnissen, Affekten, Phantasien und Handlungen. Der Ansatz ist von einem Verstehen unbewusster Zusammenhänge bestimmt (vgl. MERTENS 1991, 77-98; GEULEN 1991, 21-56).
Die Theorie stellt die Genese der Persönlichkeitsstruktur in den Mittelpunkt. Vollzogen wird sie in der Auseinandersetzung zwischen dem triebgesteuerten Kind und der triebeinschränkenden Umwelt. Antriebskräfte sind zwei Triebe, der Sexualtrieb (Libido) und der Aggressionstrieb (später Todestrieb). Sexualität wird i.w.S als Lustempfindung verstanden in den Phasen oral, anal und phallisch-genital.
Konfliktsituationen in der kindlichen Entwicklung können bespielweise entstehen beim Abstillen/ orale Phase, Reinlichkeitserziehung/ anale Phase und Auseinandersetzung mit dem Vater/ phallische Phase (vgl. KUTTER 1989).
Die Trieblehre ist in der Lehre der "psychischen Instanzen" etabliert.
- Das "Es" ist die primäre Instanz und schon bei der Geburt vorhanden mit der gesamten psychischen Ausstattung.
- Das "Ich" entwickelt sich später aus ihm und übernimmt das Wachstum, die Erfahrung, Nachahmung, das Lernen und Funktionen der Wahrnehmung, des Bewusstseins, Gedächtnisses, Denkens, Sprechens und der motorischen Kontrolle (Differenzierung in den ersten sechs bis acht Monaten als eine Art vermittelnde Instanz zwischen Es und Über-Ich?).
- Das "Über-Ich?" ist die Instanz der gesellschaftlichen Traditionen, Wertvorstellungen, Normen, Regeln nach elterlichem Vorbild und die Basis einer moralischen Instanz (Herausbildung mit fünf und sechs Jahren als Gewissensbildung).
Erfahrungen spielen bei der Realitätsüberprüfung und der Bildung des Realitätssinnes des Kindes eine große Rolle. Der "Ich-Entwicklungsprozess?" führt zu einer Kontrolle des "Es" und dessen Durchsetzung. Mit der Ausübung kommt es zu einer gewissen Schwächung des "Es".
Im Leben eines Kindes gibt es eine Reihe von typischen Angstsituationen, die in der "Ich-Entwicklung?" auftreten. Die Geburtsangst ist die erste Angst und Vorbild für die späteren Ängste wie Objektverlust, Bestrafungsangst und Kastrationsangst. Angst ist ein Symptom der Neurosenlehre und eine Erscheinung der normalen Entwicklung. Als ein Mittel von Abwehrmechanismen bildet es sich im "Ich".
Freuds Theorie hat bis heute ihre Bedeutung für die Kinderpädagogik. Es geht von einem Persönlichkeitsmodell aus, das Allgemeingültigkeit beansprucht. Allerdings hat es weitgehend spekulativen Charakter, und ist erfahrungswissenschaftlich wenig überprüft. Die Theorie beschreibt die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes vor allem im Widerstreit von Triebenergie und Triebunterdrückung. Allenfalls ein Teilaspekt der Entwicklung oder nur ein Aspekt menschlicher Entwicklung. Kritiker führen an, dass eine starke Orientierung an die traditionelle Familienkonstellation der Jahrhundertwende besteht.
Zu betonen ist der zwischenzeitige Wandlungsprozess familiärer Sozialisation und der Eltern-Kind-Beziehung? mit einem "neuen Sozialisationstyp" (vgl. BUSCH 1989, 21-42; BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 52-54). Der Begriff beschreibt die veränderten Positionen des Vaters und der Rolle der Mutter mit der Aushöhlung der Bedeutung des Vaters und der Überbürdung der Mutter-Kind-Beziehung?. Das geänderte Vaterbild sieht den Vater in seiner Bedeutung für wichtiger an, nicht nur als Vorbild für kognitive Leistungen, vielmehr als Ausdruck von Emotionen (vgl. FTHENAKIS 1993). Die Rolle der Mutter wird entlastet. Es kommt zu einer Verteilung der emotionalen Bedeutsamkeit.
Mit dem größeren Selbstbewusstsein der Frauen seit den achtziger Jahren und der Gleichberechtigung in Ehe und Beruf, kommt es zur Rückkehr des Vaters in die "vaterlose Familie" (vgl. BAURIEDL 1994, 300-302; BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 53). Damit wird von Interesse in der Folge die Rolle des Kindes als Erwachsener in der Dreieck-Perspektive? (vgl. MILLER 1994).
2.2 Lerntheorien  |  |
Die Lerntheorien setzen die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes mit Lernerfahrungen gleich.
Diese finden in lerntheoretischen Gesetzmäßigkeiten statt wie klassischer Konditionierung/ Reiz-Reaktion-Verbindungen?, instrumenteller Konditionierung/ Reaktions-Reaktions-Verbindungen? und durch soziales Lernen/ Identifikation, Imitation, Rollenverhalten(vgl. NEUSS-KÄHLER? 2022, 112-118) .
2.2.1 Klassische Konditionierung  |  |
Das Prinzip liegt in der Koppelung eines neutralen Reizes an eine Reaktion und ermöglicht eine Reiz-Reaktions-Phase?. Beim Säugling setzt beim Anblick und Fühlen der Mutterbrust eine Saugbewegung ein. Das Verhalten kann aufgebaut und ebenso auch abgebaut werden. Mit Verstärkerbedingungen wird das Verhalten gestärkt und kann mehrmals wiederholt werden.
Praktische Folgerungen hat das Prinzip/ Konditionieren im Verhalten bei möglichen Gefahren mit Angstreaktionen. In der Kindheit erfolgte konditionierte Reaktionen sind schwer zu löschen und oft die Ursache für Verhaltensstörungen (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 56).
2.2.2 Instrumentelle Konditionierung  |  |
Anders ist hier die Konditionierung auf eine Reaktion- Reaktion-Verbindung? zurückzuführen. Positive Verstärker erhöhe das Ausführen von Handlungen, negative setzen die Ausführung zurück (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 56-58).
Unterschieden wird primären und sekundären Verstärkern.
- Primäre Verstärker sind das Essen, Trinken und Schlafen.
- Sekundäre Verstärker sind Lob, Tadel und materielle Zuwendungen.
Je differenzierter in den einzelnen Situationen das Kind sich verhalten soll/ wird, desto eher kommt es zu einer Generalisierung in Form einer Reizkontrolle. Ein große Rolle spielt diese Form beim Sitzen-, Stehen-, Laufen- und Sprechenlernen. Ein Lächeln und anerkennende Mimik der Eltern/ Bezugspersonen wirken als Verstärker ("prompting"). Keine Hilfestellung/ Ausblenden bei komplexen Verhaltensweisen ( "chaining") wirkt hemmend.
Verhalten aufzubauen ist leichter als abzubauen. Kritik allein führt zu keiner Verhaltensänderung. Erfolgreicher sind konkrete Zielsetzungen gekoppelt mit Lob und Ermutigung/ Unterstützung bzw. Begleitung (vgl. DEEGENER 1990).
Ein grundlegendes Thema sind Lob und Bestrafung mit zwei Arten.
Typ I - Kind erfährt unangenehme Konsequenzen - Schimpfen oder Schläge - mit einer Unterdrückung des Verhaltens, oft nur vorübergehend. Ein Aufbau wünschenswertes Verhalten wirkt eher hemmend.
Typ II - Kind erfährt einen Entzug/ Verbot. Oft wirkt dies als Bumerangeffekt. Die Kinder unterlaufen den Entzug in einer Nichtbeachtung und fordern damit die Aufmerksamkeit der Eltern/ Bezugspersonen, um den Verstärker zu erlangen. Gelingt dies, wird das Verhalten sogar stabilisiert.
Bei Strafen gilt, sie müssen maßvoll und keineswegs willkürlich und in einer Beziehung zum Anlass sein. Strafen sollen nicht die Person des Kindes das Kindes abwerten, nur das Verhalten tadeln.
Die Umwelt hat im Entwicklungsprozess des Kindes eine große Bedeutung, wenn das Kind Veränderungen aktiv einbringt (vgl. negativ eine Anpassung und Gewöhnung). Soziale Einflüsse und Beziehungen sind wesentlich (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 58-62).
Lernen durch Nachahmung, Beobachtung und die Wirkung von Vorbildern spielen eine große Rolle (vgl. BANDURA- WALTERS 1963; BANDURA 1969). Das Lernen eines Kindes betrifft nicht nur Wissenserweiterung und Aneignung von Fertigkeiten, es betrifft ebenso soziale Kompetenzen mit Veränderung in seinem Verhalten.
Das Modelllernen nach BANDURA (1969) bei einem Kind besteht aus Beobachtung, Nachahmung, Ausführung und Motivation mit Verstärkung. Die Wirkung wird durch kognitive Hilfen in der Selbststeuerung und Selbstkontrolle verstärkt mit Lob und Anerkennung (vgl. ULICH 1991, 57-76). Es bedarf einer Empathie, eines hilfreichen Verhaltens mit Einfühlen in einen anderen Menschen, als Verstärkungsmechanismus.
Betont wird in der Lerntheorie, dass Persönlichkeitsentwicklung durch beabsichtigte und geplante Einflüsse der Umwelt erfolgen, vielmehr auch durch unbeabsichtigte und ungeplante Persönlichkeitsentwicklung und auch beiläufig erfolgen kann. Ebenso ist von Bedeutung die Vorbildwirkung von Personen real existierender bzw. auch nur vorgestellter Personen (vgl. Modellpersonen in Film, TV, sozialen Medien und der Presse).
2.3 Theorie der kognitiven Entwicklung  |  |
Jean PIAGETS (1967) strukturgenetische Theorie ging davon aus, dass das Kind aktiv auf seine Umwelt einwirkt und nicht nur von ihr beeinflusst wird (vgl. ausführlich In BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 62-68). In einem Prozess der Selbstkonstruktion kommt der Impuls von außen, letztlich geht er vom Kind aus.
Die Theorie geht von Stadien aus, wobei jedes Stadium auf dem vorhergehenden aufbaut und selbst wieder eine Voraussetzung für das nächsthöhere bildet. Entwicklung heißt nach PIAGET, das Kind bildet "Strukturen" (bestimmte Denkverhaltensweisen), die zur Veränderung sich bilden, also zu Strukturen auf höherer Ebene in Form von komplexeren und übergreifenden Systemen. Entwicklung ist kein additiver Prozess, vielmehr ein Prozess der fortschreitenden Differenzierung. Neue Strukturen verändern die alten und bilden ein verändertes Ganzes.
2.3.1 Äquilibrationsmodell  |  |
Äquilibration ist eine selbstregelnde Anpassung des Organismus an die Umwelt.
Die Grundlage der kindlichen Entwicklung nach PIAGET bilden sensomotorische Aktionsschemata, nach deren Muster das Kind alle Formen des Erkennens erwirbt. Vorstellungen über die Genese des Erkennens sind stark biologisch-naturwissenschaftlich bestimmt.
Die Entwicklung vollzieht sich im Zyklus der Aquilibration und mit jedem neuen Zyklus von Assimilation, Akkomodation und Organisation wird die Aktivität des Individuums höher strukturiert (vgl. WIEGAND 1992, 151).
Jeder Anpassungsvorgang ist subjektorientiert (Assimilation) und objektorientiert (Akkomodation): Erkenntnis (epistemischer Aspekt), Entwicklung (genetischer Aspekt) und Anpassung (adaptiver Aspekt). Im Mittelpunkt steht der Erkenntnis steht das Äquilibrationsmodell.
2.3.2 Stadien der kognitiven Entwicklung  |  |
"Die gesamte Entwicklung eines Kindes und seine kognitive Entwicklung ist eine Abfolge strukturell verschiedener Perioden" (BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 63). Das Auftrittsalter und die Periodendauer sind variabel und abhängig von der Intelligenzhöhe und den Sozialisationsbedingungen.
Die Abfolge der Perioden ist unveränderlich. Unterschieden werden die folgenden Perioden.
- Periode der sensomotorischen Intelligenz. Sie erstreckt sich von 0-24 Monaten in mehreren Phasen. Das eigentliche Beginn ist die Koordination von Sehen und Greifen mit Heranholen des Gegenstandes. In den ersten 18 Monaten sieht das Kind sich als Mittelpunkt (Egozentrismus), in der Folge kommt es zu einer räumlichen Erweiterung/ Strukturierung (vgl. PIAGET-INHELDER? 1972, 23).
- Periode des symbolischen Denkens. Sie erstreckt sich von 2-4 Jahren und wird mit der Sprache erworben. Das Kind agiert mit Vorstellungen, Symbolen und Zeichen. In der Folge ist das Kind unabhängiger von der Umwelt und agiert sozial mit der Sprache.
- Periode des anschaulichen Denkens. Sie erstreckt sich von 4-7 Jahren. Gekennzeichnet ist die Wahrnehmung anschauungsgebunden durch konkrete Bildhaftigkeit und Konzentration auf Merkmale eines Objekts.
- Periode der konkreten Operationen. Sie erstreckt sich ab ca. 7-8 Jahren. Das Kind wird zum verinnerlichten Denken fähig und verschiedene Wahrnehmungen zu koordinieren und zu kompensieren sowie zur Umkehr von Handlungen ("Reversibilität").
- Periode der formalen Operationen. Ab etwa 12 Jahren befasst sich das Denken mit möglichen und abstrakten Formen und Strukturen. Das formale Denken besteht in Reflexionen über formale Operationen ("Operieren mit Operationen").
2.3.3 Entwicklung eines moralischen Urteils  |  |
PIAGET verwendet in der Entwicklung eine Fragetechnik, in der in den Antworten auf den Entwicklungsstand geschlossen wird ("methode clinique"). Er unterscheidet zwei Stufen der moralischen Entwicklung, die heteronome und autonome Moral (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 66).
- In der ersten Stufe bis acht Jahre richtet sich das Kind nach den Vorgaben der Eltern und unterscheidet nach richtig und falsch ("moralischer Realismus"). In der Folge wird die Situation und die Begründung erkannt.
- Hier kommt es zum Übergang in die zweite Stufe einer autonomen Moral mit der Erkenntnis der Notwendigkeit von Regeln bzw. Normen. Damit entwickelt sich auch die Möglichkeit einer sozialen Kooperation unter Kindern und Interaktion von Gleichaltrigen.
Das Verständnis von Gerechtigkeit entsteht weniger unter dem Einfluss von Erwachsenen, vielmehr aus dem Zusammengehörigkeitsgefühl bzw. der Solidarität zwischen den Kindern und der Entwicklung der kognitiven und sozialen Faktoren auf beiden Stufen.
2.4 Theorie der sozialen Interaktion  |  |
George Herbert MEAD (1968) haben sozialpsychologische und soziologische Theorien der Persönlichkeits- und Subjektbildung beeinflusst. Besondere Bedeutung erfährt der Ansatz in der Identitätstheorie und Rollentheorie.
2.4.1 Identitätstheorie  |  |
Im Heranwachsen entwickelt sich die Fähigkeit im Verhalten des Kindes eine Persönlichkeitsstruktur und in der Folge Identität zu bilden (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 69). Nach der Theorie von MEAD (1968) kommt es zu zwei Größen des "I" als psychische und "Me" als soziale Komponente.
- Das I versteht sich als individuelle Äußerung und Reaktion des Kindes.
- Das Me versteht sich als Einstellung und Verhaltenserwartung zur Orientierung des Gegenübers. Unter dieser Kontrolle entwickelt sich ein Selbstbild bzw. Selbst zu einer Ich-Identität? (vgl. JOAS 1991, 137-152).
Eine solche Identität entsteht aus dem Zusammenspiel beider Größen, dem Handeln des Kindes letztlich zu einer Bildung einer Persönlichkeit.
2.4.2 Theorie der sozialen Rolle  |  |
Eine soziale Rolle versteht sich als normative Verhaltenserwartung, die von einer Bezugsgruppe bzw. Bezugspersonen in einer Person in sozialer Position bzw. von einem Kind erwartet wird (vgl. JOAS 1991, 137-152). Als solche gelten Eltern, Verwandte und später Lehrende und Erziehende.
In bestimmtem Ausmaß werden soziale Rollen durch Tradition und Kultur festgelegt. Jedes Kind hat Spielräume in der Entwicklung und den Erwartungen, betont wird in der Theorie der sozialen Rolle die aktive Rolle des Kindes bei der Konstruktion und Interpretation von sozialen Situationen. In einem ersten Schritt muss gelernt werden, die Meinung des Anderen bzw. der Bezugsperson zu erfassen und dessen Verhalten zu antizipieren. Ein rollengerechtes Verhalten wird vom Gegenüber erwartet.
Nicht nur die Selbstwahrnehmung soll sich entwickeln, auch die Übernahme der Perspektive des Anderen/ Perspektivenwechsel soll früh ermöglicht und altersgemäß geübt und erlernt werden (vgl. die Bedeutung in der Folge in einer pluralen Gesellschaft).
2.4.3 Symbolische Interaktion  |  |
Mit dem Begriff "Interaktion" hat MEAD die Wechselbeziehung von Individuum und Umwelt sowie die innere Beziehung der einzelnen Menschen mit dem Anderen bezeichnet. Interaktives Handeln behandelt die Erwartungen des Anderen und verursacht Antizipationen (Vermögen einer Vorwegnahme von Erwartungen in der Zukunft). Dies gelingt nur durch ein Hineinversetzen in den Anderen und einen Perspektivenwechsel (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 70-72).
In der Interaktion zwischen Kindern und Kindern und Erwachsenen gibt es viele Symbole, etwa die Sprache und Kommunikation als Bedeutungsträger. Man hört sich selbst und sieht die Gesten des Anderen. MEAD spricht von einer "intersubjektiven Identität" und leitet dies zur Fähigkeit der Übernahme einer Rolle ab. Sich in den Anderen hineinversetzen und einzuschätzen verlangt ein Aufbringen von Empathie (Einfühlungsvermögen).
MEAD sieht im Menschen einen kreativ Handelnden, demnach der seine Umwelt gestaltet und bearbeitet. Nach dem interaktionistischen Modell des kommunikativen Austausches werden die wechselseitigen Rollen miteinander abgestimmt. Es bedarf einer Sprachkompetenz und empathischer Fähigkeit mit der Fähigkeit sich selbst und sein Handeln reflexiv zu betrachten.
2.5 Integrative Theorien  |  |
2.5.1 Systemisch-ökologische Theorien  |  |
Die Theorien sehen den Menschen als Gestalter seine Entwicklung, reflektierendes Wesen mit der Fähigkeit, sich selbst von sich ein Bild und der Umwelt zu machen und beide zu modifizieren (vgl. BRONFENBRENNER 1981). Der Mensch und seine Umwelt werden als Gesamtsystem gesehen, beide beeinflussen sich wechselseitig ("transaktional"). In der systemischen Sichtweise werden beide Einflussrichtungen berücksichtigt (vgl. OERTER 1995, 84-127).
In diesem Zusammenhang werden auch Erklärungen für die Einflüsse im Rahmen des Familiengeschehens von Eltern auf die Kinder oder auch vom Kind aus auf die Eltern beschrieben (vgl. GERRIES - DE BROCK - KENTGES-KIRSCHBAUM? 1991, 242-262). Benannt wurden die Einflussfaktoren "retroaktive Sozialisation".
KLEWES (1983) untersucht die Wirkungen von Kindern auf das Verhalten von Eltern, wobei zirkuläre Verstärkungsprozesse angenommen werden, die kindliche und elterliches Verhalten steuern.
Die Wechselwirkung bei der Entstehung aggressiven Verhaltens bei Kindern ist gut dokumentiert (vgl. PETERMANN 1993). Schon der Beginn der Schwangerschaft, der Verlauf und die Geburt selbst können die Einstellung der Eltern und besonders der Mutter positiv bzw. negativ beeinflussen. Kindliche Verhaltensauffälligkeiten beginnen schon früh nach der Geburt, etwa ein Unruheverhalten.
Nach PETZOLD (1992) beeinflussen nicht nur Eltern ihre Kinder, auch Kinder den Erziehungsstil ihrer Eltern im Verhalten, Ansichten, Einstellungen und Werthaltungen. MONTADA (1995) beschreibt die Mechanismen der Kinder. Ein Zerwürfnis der Eltern kann seinen Grund im Verhalten der Kinder haben. Ohne fachliche Hilfe können die Verhaltensprobleme kaum durchbrochen werden (vgl. Zirkularität der Beziehungen).
Die entscheidenden Wechselwirkungen in der Beeinflussung dauern ein Leben lang wie etwa im Eintritt in den Kindergarten, Schulbeginn, Schulabschluss, Lehre oder Studium und Beziehungen zueinander.
Systemisch gesehen kennzeichnet eine Familie die Aspekte (vgl. SCHNEEWIND 1995, 128-166)
- Ganzheitlichkeit - Summe ihrer Mitglieder (Interaktion, Kommunikation)
- Zielorientierung - Gestaltung von Bedürfnissen
- Regelhaftigkeit - Gewohnheiten, Rituale und Eigentümlichkeiten
- Zirkuläre Kausalität - Interaktionszyklus
- Grenzen - Abgrenzung nach außen und auch innen
- Homöostase - Erhaltung eines Kräftegleichgewichts und Erhaltung der Stabilität
Das Kind und der Einzelne bzw. die Gruppe leben in ökologischen Systemen mit allen Einrichtungen, die eine biologisch-psychologische Entwicklung ermöglichen. Die "Mensch-Umwelt-Systeme?" ergeben eine Kombination von Subjektabhängigkeit und Objektbezogenheit (vgl. NICKEL 1995, 77-81).
Das Kind lebt in einer mehrschichtigen Umwelt in fünf Systemen mit vielen Verbindungen (vgl. BRONFENBRENNER 1981).
- Mikrosystem - Familie mit den Untersystemen
- Mesosystem - Verbindungen mit anderen Mikrosystemen wie Kernfamilie und Elternfamilie, Kindergarten, Schule und Freundeskreis der Kinder
- Exosystem - Verbindungen mit Personen, die indirekt beeinflussen
- Makrosystem - Verbindungen zur Gesamtkultur mit Werte- und Normensystem
- Chronosystem - Verbindungen zum Zeitfaktor als wichtiger Faktor der Entwicklungsprozesse
Die einzelnen Handlungsfelder erfordern auch einen Wechsel der Verhaltensmuster. Entwicklung ist die Fähigkeit, neue Handlungsmuster sich zu verschaffen. Erfahrungen fördern die Teilhabe an vielen Settings.
Wichtig ist die Teilnahme der Eltern am Leben im Kindergarten und in der Folge in der Schule. Mit der Unterstützung durch eine positive Haltung erleichtert man das Leistungsstreben und eine Anstrengungsbereitschaft.
2.5.2 Sozialisationstheorie  |  |
Unter Sozialisation versteht man den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung in Abhängigkeit und Auseinandersetzung mit der inneren (Körper und Psyche) und äußeren Realität (soziale und ökologische Umwelt) (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 80-81; NEUSS-KÄHLER? 2022, 123-133).
Die Entwicklung bzw. der Prozess verläuft individuell, in Interaktion und Kommunikation in erworbener Organisation/ Handlungsbereitschaft und Selbstwahrnehmung.
Die Sozialisationstheorie berücksichtigt anthropologische, biologische, gesellschaftliche, kulturelle und psychische Aspekte. Als Grundannahme gilt eine "produktive Realitätsverarbeitung". Sozialisation ist ein lebenslanger Prozess. Die Entwicklungsschritte in den einzelnen Lebensphasen bilden die Voraussetzung/ Basis für die kommenden. Frühere Sozialisationsphasen sind daher von großer Bedeutung und bilden jeweils die Grundstrukturen.
Wichtige Sozialisationsinstanzen sind die Familie, die Erziehungs- und Bildungseinrichtungen in ihrer Breite wie die Eltern, der Freundeskreis - der Kindergarten, die Schulen, Betriebe/ Unternehmen - Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen. Je aktiver die Möglichkeiten genützt werden (können), desto reibungsloser vollzieht sich der Übergang von einer Rolle zur anderen in der Biographie.
Für die beiden Geschlechter werden die Bedingungen in der Sozialisationstheorie ausführlich thematisiert (vgl. TILLMANN 1994, 41-43). Der Prozess der Konstruktion des Geschlechts als soziale Kategorie ("gendering") bezeichnet die Verbindung von spezifischen Interaktionsformen und Rollenbildern (vgl. BÖHNISCH-WINTER? 1994).
In den wandelnden Rahmenbedingungen mit den Konsequenzen der Persönlichkeitsentwicklung verändern sich die Rollenbilder, womit sich neue zentrale Fragen der Sozialisationsforschung ergeben.
3 Lebensbereiche der Kinderbildung  |  |
3.1 Angebot der Kinderbetreuungseinrichtungen  |  |
Neue Familienlebensformen und neue Biografien von Frauen führen zur anderen/ veränderten Lebensrealität von Eltern und Kindern. Die Familie ist kleiner, sie ist anfälliger geworden (man denke an den Vergleich mit einem dreibeinigen Stuhl). Die Einelternfamilie und Einzelkinder gehören zum heutigen Bild einer Familie. Berufstätige Mütter sind auf außerfamiliäre Betreuung der Kinder angewiesen (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996., 122-129).
Tageseinrichtungen sind Orte, in denen Kinder von vier Monaten an bis zum 14. Lebensjahr Betreuung, Bildung und Erziehung erhalten. Sie sichern, vergrößern und verbessern den Lebensraum der Kinder.
- Kinderkrippen und Krabbelstuben - Säuglinge ab vier Monaten und Kleinkinder bis zu drei Jahren
- Kindertagesstätten - jüngere und ältere Kinder
- Kindergärten - Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt
- Horte - Kinder von sechs bis 14 Jahre
Tagesmütter ergänzen das Angebot auf Grund privater Initiativen und bedürfen einer offiziellen Anerkennung durch die Jugendämter.
3.2 Kindergarten  |  |
Mit der Entstehung des Kindergartens Mitte des 19. Jahrhunderts war zunächst eine sozialpolitische Intention verbunden (Versorgung der Kinder und weg von der Straße) und eine pädagogische (Bildung und Erziehung).
Friedrich FRÖBEL setzte die Maßstäbe, konnte aber das Image einer Kinderbewahrungsstätte nicht verhindern. Kindergarten und auch der Hort sind sozialpädagogische Einrichtungen mit eigener Erziehungs- und Bildungsaufgabe.
In den siebziger Jahren der "pädagogischen Wende" änderte sich die Einstellung zum Kindergarten mit einer Förderung der kognitiven Fähigkeiten und dem Ziel einer kompensatorischen Erziehung wie etwa mit Lern- und Denkspielen, Sprachtrainingsmappen und Trainingsprogrammen zur visuellen und akustischen Differenzierungsfähigkeit (vgl. HEBENSTREIT 1994) .
3.2.1 Pädagogische Konzepte  |  |
 | | Pädagogische Konzepte |
| | Pädagogische Ziele | Gesellschaftliche Einstellungen |
| 1950 | Bewahren und Betreuen | Betreuung als Notbehelf
Primat familiäre Erziehung |
| 1970 | Förderung durch Lernprogramme | Unterstützung der Bildungsanforderungen
Konkurrenz zur Familienbetreuung |
| 1980 | Förderung der sozialen Entwicklung | Unterstützung der Anforderungen an Kindheit
Familienentlastung |
| 1990 | Integrative Erziehung - Auseinandersetzung mit Umwelt | Kindergarten als Lebensraum
Einheit - Familie und Institution |
|
|
Quelle: BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 130
Kindergärten sind als Orte der Begegnung, Kontakte zu knüpfen und soziale Erfahrungen zu bilden (vgl. KRENZ 1994). Gruppenleben mit Spiel- und Lerngruppen regt an, über Vorlieben und Abneigungen nachzudenken (Identitätsbildung). Kinder brauchen Kinder zur Gestaltung von Beziehungen und Freundschaften zu erleben.
Koedukative Erziehung im Kindergarten soll das Selbstvertrauen von Mädchen und Buben in Handlungs- und Rollenspielen entwickeln (vgl. VERLINDEN 1995).
Spielen und Lernen sind miteinander verbunden. Spielverhalten besitzt Merkmale (vgl. OERTER 1995, 84-127) wie den/ die
- Selbstzweck - Erleben von Lust und Freude
- Realitätsbezug - Konstruktion einer eigenen Realität
- Wiederholung und Ritual - gleicher Ablauf
Nach EINSIEDLER (1994, 17) kommt das Kinderspiel durch freie Wahl zustande, das nur auf den Ablauf gerichtet ist.
3.2.3 Bewegungsangebote  |  |
Wesentlich ist für die Kinder sich wohl zu fühlen und sich frei bewegen und auch gestalten zu können. Bewegungsangebote ergeben sich etwa in einem Garten, Spielwiese, Gymnastikraum, Spielhäuschen, Spielplatz und Gruppenräumen zum Zurückziehen in Nischen, Ecken und Höhlen.
Die Struktur eins Kindergartens ergibt eine Heterogenität im Unterschied zur Schule. Die verschiedenartige Zusammensetzung ermöglicht soziale Erfahrungen, fördert Toleranz, Rücksicht, Hilfeleistung und das Spektrum sozialen Lernens.
Eine Altersmischung ermöglicht Gruppenbildungen mit gleichen Interessen, Möglichkeiten und Begegnungen.
Ausländische Kinder fördern eine interkulturelle Begegnung mit anderen Lebensformen, Fähigkeiten, kulturellen Einflüssen wie dem Liedgut, Festen und Ritualen und können die individuelle Entwicklung bereichern.
Als neuer Schritt in der Entwicklung eines Kindes ist der Übergang in den Kindergarten reibungslos zu organisieren, mit einer guten Zusammenarbeit gelingt dies im Austausch, auch mit anderen Eltern, über verschiedene Erziehungsstile.
Zu erwarten ist das Angebot an informellen Elterntreffs und Elternabenden, ggf. der Unterstützung bei Festen, Bastelnachmittagen und Ausflügen. Ziel einer Elternarbeit ist den Kindergarten als "offene Institution" zu sehen. Die Eltern und Institution als Ganzheit mit Hinweisen und Hilfestellungen zu erleben. Ein gemeinsames Verantwortungsgefühl schafft ein gegenseitiges Verständnis für die Erziehungsarbeit (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 142-143; NEUSS-KÄHLER? 2022, 211-223).
Die Veränderungen in der Lebenswelt der Kinder sind in der Schule im Schulleben, Unterricht, Klassenklima und der Schulentwicklung zu berücksichtigen.
Die Erwartungen an die "Schule" - Lernende - Lehrende - Schulleitungen - Schulaufsicht - Eltern - Schulerhalter - Bildungs-/ Schulpolitik sind gestiegen. Die einzelnen Schulpartner haben widersprüchliche Erwartungen, pädagogische Arbeit ist vielfältig geworden, sie ist anspruchsvoll (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 156-201; DICHATSCHEK 2022ab; NEUSS-KÄHLER? 2022, 14-20).
3.3.1 Leistungserwartungen  |  |
Als wesentliche Sozialisationsinstanz dominiert Schule die Lebensbereiche der Kinder als Lernende, die einen Großteil ihrer täglichen Zeit in der Schule verbringen. Sie beeinflusst das Verhalten von Eltern und Kindern durch die Erwartungen.
Mit Schulbeginn kommen neue Anforderungen auf die Kinder zu. Schule ist vorwiegend auf Leistung reduziert. Ihre Bewertung dominiert den Schulalltag. Wesentlich ist das Leistungsverständnis, als pädagogisches Verhalten auf das Kind orientiert. Nicht nur kognitive, auch soziale, gestaltende bzw. musische und sportliche Fähigkeiten sind zu würdigen.
Viele Faktoren bestimmen die Schulleistung, etwa die Begabung, Motivation, Ausdauer, Konzentration, Erfolgszuversicht und das Selbstwertgefühl. Familie, Persönlichkeit der Lehrenden und Schulorganisation sind ebenso bestimmend.
Eltern erwarten einen schulischen Erfolg, persönlich und auch für einen sozialen Aufstieg des Kindes. Zu bedenken ist allerdings die individuelle Persönlichkeitsentwicklung des Kindes mit dem Ziel einer Selbständigkeit und freien Entfaltung. Viele Eltern stellen zwischen den Parallelklassen Leistungsvergleiche an und reagieren mitunter beunruhigend. In diesem Zusammenhang treten für einen Leistungsstand Benotungsvergleiche auf. Damit ist ein Diskurs über die Beurteilung (verbal vs. Ziffer) schon im Primarbereich eröffnet. Negativ stellt sich Noten- und Leistungsdruck ein.
Eine zentrale Frage für das Verhältnis Familie - Schule ist der Bereich der Hausaufgaben bzw. Festigung der schulischen Arbeit in Verbindung mit der Entwicklung zur Eigenständigkeit und Eigeninitiative der Kinder. Das häusliche Schulleistungstraining bedarf klarer Absprachen und Regelungen zur Vermeidung von Konfliktsituationen
 (Elternberatung - Elternsprechstunde/ Elternsprechtage - Elternabend). (Elternberatung - Elternsprechstunde/ Elternsprechtage - Elternabend).
Eine ebenso zentrale Frage stellt sich beim Übergang vom Primar- in den Sekundarbereich. Realistisches Leistungsdenken bzw. Bildungserwartungen bedürfen einer Bildungsberatung oder/und einer schulpsychologischen Diagnostik (vgl. die Wichtigkeit einer Beratungskompetenz Lehrender >  http://www.netzwerkgegengewalt.org/wiki.cgi?Beratungskompetenz). http://www.netzwerkgegengewalt.org/wiki.cgi?Beratungskompetenz).
Der gängige Ausdruck "Schulstress" lenkt von den soziokulturellen Bedingungen eines Belastungs- und Bewältigungssymptoms ab. Das Kind benötigt zur Entspannung und Erholung am Nachmittag Handlungsmöglichkeiten ohne Stressfaktoren. Es bedarf im Einzelfall der Beurteilung der Situation (vgl. LAZARUS 1981, 198-232; ZIMMER 1981 - Bausteine des Stressmodells, Erprobung und Erlernen einer Entspannungstechnik).
3.3.2 Lebens- und Entwicklungsraum  |  |
Auch im Primarbereich fanden zu den veränderten Lebensbedingungen bereits mit einem Projektunterricht und Arbeitsgemeinschaften didaktische Möglichkeiten mit aktuellen Anregungen statt.
Fächerübergreifendes Lernen und Zusammenarbeit ergeben Freiräume im Unterricht und Schulleben. Schule reagiert damit auf entwicklungspädagogische, kulturell-religiöse und sozioökonomische Unterschiede und hat Bewegung, Spiel und Sport zu beachten (vgl. SCHWIER-SEYDE? 2022).
Damit kommt es zu einer Vielfalt von Unterrichtsformen und Unterrichtskonzepten im Kontext von veränderten Lebenswelten und Unterschieden.
Der Begriff "Erziehung" bezeichnet einen Zustand und eine Zielbeschreibung. "Erziehen" beschreibt dagegen einen Prozess zwischen Personen als zwischenmenschliches Handeln mit der Mitwirkung der zu Erziehenden. Kinder nehmen am Geschehen teil, in jedem Fall gestalten sie und verändern sie den Prozess. Im Primarbereich heißt dies eine organisierte Hilfestellung zur Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten (vgl. WITTENBRUCH 1989, 32).
"Erziehender Unterricht" löst als Begriff missverständlich einen Gegensatz aus. Lehrende besonders im Primarbereich benötigen für ihre Bemühungen eine Kombination beider Bereiche in jeder Unterrichtssequenz für eine ganzheitliche Lernerfahrung.
Lernanlässe und Situationen einer Lebensbewältigung können vom Sachunterricht ausgehend entsprechend behandelt werden. Benötigt werden Absprachen und Einübungen für soziale Aktivitäten. Lernen wird als aktiver, produktiver und reflexiver Prozess gesehen.
Der Teilbereich Personalentwicklung (Lehrerfort- bzw. Weiterbildung) und Unterrichtsentwicklung befasst sich mit der Gestaltung von Schule in den verschiedenen Facetten im Kontext einer notwendigen Bildungsreform. Schule bildet im pädagogischen Selbstverständnis eine Leistungs- und Handlungseinheit. Zur Schulentwicklung gehört auch noch eine Organisationsentwicklung. Der Innovationsdruck erfordert eine Weiterentwicklung in einer pluralen Gesellschaft (vgl. DICHATSCHEK 2022ab, 2023).
Dem Wissensmanagement kommt eine besondere Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang wird von einer "lernenden Organisation" - Lehrende-Lernende-Eltern-Schulaufsicht? - gesprochen.
Einer Schulentwicklungsberatung zur Koordinierung der einzelnen Schritte zur Schulentwicklung an Einzelschulen oder einem Schulverbund kommt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Bedeutung zu.
Im Hinblick auf die Reform der Lehrpläne durch das Bildungsministerium wird die Schulentwicklung aktualisiert >
 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erk/lp_neu_kund.html (12.1.2023) https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erk/lp_neu_kund.html (12.1.2023)
4 Freizeit und Medien in der Kinderbildung  |  |
4.1 Freizeitverhalten  |  |
Infolge massiver Veränderungsfaktoren in den Lebensbedingungen und der Alltagsgestaltung von Kindern hat sich der Tagesablauf verändert und neue Freizeitaktivitäten als Folge gesellschaftlicher, sozioökonomischer und ökologischer Veränderungen dazukommen. Die Freiräume und Aktivitäten sind enorm gewachsen (vgl. ausführlich BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 204-220; FRREERICKS-HARTMANN-STECKER? 2010).
Bei den Kindern gibt es immer noch ein großes Spektrum an Aktivitäten. Weder die technisch-elektronischen Geräte noch das Fernsehen haben das Buch verdrängt, die Puppen, Kuscheltiere, der Umgang mit lebenden Tieren und das freie Spiel haben ihren Stellenwert verloren. Institutionalisierte Angebote wie Sport in Vereinen, Erlernen eines Instruments in der Musikschule oder Malen, Basteln und Kochen werden angenommen (vgl. zum Kinderzimmer ZINNECKER 1990, 142-162).
Bevorzugte Spielorte sind altersgemäß die Nähe zu den Eltern das Haus, der Garten und der Spielplatz. Außenaktivitäten sind Radfahren, Versteck- und Fangenspiel, Rollschuhlaufen und Schwimmen, in Wintersportgegenden der Schilauf, Rodeln und Eislauf. Kinder besuchen sich gerne, hier gibt es schichtenspezifische Unterschiede. Freizeitangebote bieten Vereine, Verbände und Bildungseinrichtungen an (vgl. FÖLLING-ALBERS?/HOPF 1995).
Freundschaftsbeziehungen je nach Erfahrungen und Erlebnissen bilden sich im Kindergarten und der Schule gerne.
4.2 Medien  |  |
Kinder wachsen heute mit einem großen Medienangebot auf. Zu unterscheiden sind Printmedien wie Bücher, Bilderbücher, Comics und Zeitschriften, Hörmedien wie Radio, Walkman und CD-Player?, TV-Medien? TV-Gerät?, Video und elektronische Medien wie Gameboy Personalcomputer, Kindercomputer, Videotext, Fax, Bildtelefon und Online-Dienste? (vgl. ausführlich BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 221-254; PLAKE 2004).
Die Entwicklung geht in Richtung einer Vernetzung von Schrift, Bild, Film, Ton und Sprache. Das Medienverbundsystem beinhaltet die Anwendung verschiedener Medien. Die zeitgemäße Medienkultur ist multimedial organisiert (vgl. CHARLTON/ NEUMANN-BRAUN? 1992, 7). Kinder verfügen über eine Vielzahl von audiovisuellen Medien. Medienspielsachen sind verbreitet.
Bildbücher sind in der Kleinkindpädagogik sehr verbreitet. Geliebt werden Geschichten zur Anregung der Phantasie. Kassettenrecorder haben das Vorlesen abgelöst.
Für viele Kinder ist das Fernsehen der "beste Freund". Kinder-TV? hat es nicht immer gegeben. Sendungen wie "Sesamstraße" oder "Rappelkiste" werden gerne von Kindern und Eltern angenommen.
Medien bestimmen den Tagesrhythmus und das Spielverhalten der Kinder. Gemeinsam mit den Eltern fernsehen ermöglicht Handlungen zu erklären und Hilfestellung für ein Verständnis zu geben.
Nach PLAKE (2004, 196) lag die Sehdauer von Kindern 2002 bei 97 Minuten. Konstant war der Umfang der Nutzung, erstaunlich bei der zugenommenen Umwerbung der jüngsten Zuschauergruppe.
Kinder des Primarbereichs können bereits ausgesprochene Computerfans sein. Anwendungsprogramme kann man einteilen in Lern- und Förderprogramme, Spiele, Textverarbeitung, Mal- und Zeichenprogramme.
Aus unterschiedlichen Gründen sehen Kinder fern. Das Nutzungsverhalten ist von ökonomischen, ökologischen, beruflichen, sozialen und familiären Bedingungen der Eltern abhängig.
Stadtkinder sehen mehr fern als Landkinder. Einzelkinder mehr als Geschwisterkinder, ausländische Kinder mehr als einheimische. Ein wichtiger Einfluss ist der Einfluss der Eltern, ihre Sehgewohnheiten und Ausbildung. Gründe für ein beliebtes Fernsehen sind im allgemeinen Entspannung, Träumen von einer anderen Welt, etwas lernen, erleben von Abenteuern, aufregend finden und gute Unterhaltung.
Medienerziehung ist Teil der Medienpädagogik >  http://www.netzwerkgegengewalt.org/wiki.cgi?Medienarbeit (12.1.2023 ). http://www.netzwerkgegengewalt.org/wiki.cgi?Medienarbeit (12.1.2023 ).
Medienerziehung beinhaltet Medienkunde, Medienkritik und Medienanwendung(vgl. BRANDTÄTTER-BRANDSTÄTTER? 1995).
- Medienpädagogik in der Familie - Eignung der Sendung - Sendezeit-Dauer? - Gespräch
- Medienpädagogik im Kindergarten - Gespräch-Entspannung? -Medienerlebnis - Handlungsfreude
- Medienpädagogik in der Schule - Vorkenntnisse, Medienkonsum/ Printmedien-elektronische Medien - Unterrichtsnutzen/ Eigengestaltung-Rollenspiel? - Medienanalyse/ Medienkritik - Netzwerke
5 Gesundheitsprobleme  |  |
5.1 Gesundheitsgefährdungen  |  |
Ausgangssituation sind die Zusammenhänge zwischen sozialen und ökologischen Umweltfaktoren/soziokulturelle bzw. sozioökonomische Faktoren und körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen. Zu überwinden ist eine einseitige medizinische Sichtweise (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 255-261).
Risikofaktoren und Belastungen aus dem sozialen und ökologisch-ökonomischen Umfeld bedürfen zunehmend einer Beachtung. Ziel ist die Aufrechterhaltung von Gesundheit und Risiken zu vermeiden.
Beispielhaft sind etwa Beziehungs- und Anerkennungsprobleme, Orientierungskrisen, unzureichende motorische Entfaltungsmöglichkeiten, falsche Ernährung und Schadstoffbelastungen Beeinträchtigungen, die es zu erkennen gilt.
Anstoß für solche Aspekte hat bereits 1946 die Weltgesundheitsorganisation/WHO gegeben. Gesundheit wird definiert als ein Zustand des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur als das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen. Trotz der vorhandenen Kritik lohnt es sich, mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen. Die Balance zwischen objektivem und subjektivem Wohlbefinden beim Kind ist in seiner Entwicklung zu berücksichtigen.
Gesundheit wird also als Gelingen einer Sozialisation angesehen. Eine Abstimmung von Anforderungen und Bedürfnissen ergibt sich in den Bereichen
- Körper - Konstitution-Veranlagungen-psychische? Eigenschaften
- Soziale Lebenswelt - Familie-Freunde-Lernen-Tätigkeiten-Anerkennung-Unterstützung-Begleitung?
- Umwelt - natürliche Bedingungen-Wohnumwelt-Freizeitmöglichkeiten-Interessen? und Neigungen
- Persönliche Gesundheit - Lebensbewältigung
Veränderungen im Gesundheitsspektrum ergeben sich neben chronischen körperlichen Erkrankungen/Beeinträchtigungen, beispielhaft bei Allergien, angeborenem Herzfehlern, Diabetes/Stoffwechselerkrankungen, Epilepsie, Asthma, Störungen im Essverhalten, Auffälligkeiten im Wahrnehmungs- und Leistungsbereich und Hyperaktivität (ausführlich BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 276-288).
5.2 Gesundheitsförderung  |  |
Das Konzept geht von einer Vorbeugung aus, die Gesundheitserziehung, Gesundheitsberatung und Gesundheitsbildung beinhaltet. Eingewirkt werden soll auf den Ebenen Motivation, Handeln und Lebensbedingungen. Zu berücksichtigen sind die medizinische, kulturelle, soziale und ökologische Lebenssituation und zu beeinflussen (vgl. BRÜNDEL-HURRELMANN? 1996, 289-293).
Prävention soll daher mehr als Maßnahmen gegen Risikofaktoren eingesetzt werden, etwa bei Krankheit, Leistungsabfall und Verhaltensstörungen. Maßnahmen der Medizin/ Impfungen-Untersuchungen?, Leistungsförderung/ Unterstützung-Hilfestellung?, Kompetenztraining und Beratung wären anzustreben. Träger der Gesundheitsförderung sind in der Folge Lehrende, Schulärzte, Schulpsychologen und Elternberater im Verbund mit den kompetenten Institutionen.
Ausgebaut gehört in einer Bildungsreform der Beratungsdienst (vgl. die Notwendigkeit von Beratungskompetenz im Bildungsbereich; DICHATSCHEK 2023). Im schulischen Bereich kann relativ kurzfristig in einem standortbezogenen Schulentwicklungsprozess ein Maßnahmenkatalog erstellt werden.
Literaturverzeichnis I  |  |
Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und/oder direkt zitiert werden.
Aries P. (1978/2007): Geschichte der Kindheit, München
Bandura A. (1969): Principles of behavior modification, New York
Bandura A. - Walters R.H. (1963): Social learning and personally development, New York
Bauriedl Th. (1994): Auch ohne Couch. Psychoanalyse als Beziehungstheorie und ihre Anwendungen, Stuttgart
Brandstätter-Brandstätter? R. (1995): Fernsehen mit Kindern. Ein Ratgeber für Eltern, Wien
Bronfenbrenner U. (1981): Die Ökologie der menschlichen Entwicklung, Stuttgart
Bründel H.- Hurrelmann K. (1996): Einführung in die Kindheitsforschung, Weinheim-Basel?
Böhnisch I. - Winter R. (1994): Männliche Sozialisation. Bewältigungsprobleme männlicher Geschlechtsidentität im Lebenslauf, Weinheim - München
Busch H.-J. (1989): Kindheit am Ende oder Ende ohne Kindheit? Psychonanalytisch-sozialpsychologische As0ekt veränderter Sozialisationsbedingungen von Kindern, in: Geulen D. (Hrsg.): Kindheit. Neue Realitäten und Aspekte, Weinheim, 21-42
Charlton M./ Neumann-Braun? K. (1992): Medienkindheit - Medienjugend. Eine Einführung in die aktuelle kommunikationswissenschaftliche Forschung, München
Deegener G. (1990): Grundlagen der Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, Weinheim
Dichatschek G. (2022a): Schulentwicklung 1 - Unterrichtsentwicklung und Personalentwicklung, Saarbrücken
Dichatschek G. (2022b): Schulentwicklung 2 - Organisationsentwicklung, Saarbrücken
Dichatschek G. (2022c): Grundwissen Politische Bildung - Theorie, Praxis und Handlungsorientierung, Saarbrücken
Dichatschek G.(2022d): Grundwissen Erziehung - Erziehung und Bildung in Theorie und Praxis, Saarbrücken
Dichatschek G. (2023): Grundwissen Beratungskompetenz. Theorie, Praxis und Handlungsfelder im Bildungssystem, Saarbrücken
Dieterich C. - Stenger U.- Stieve C. (Hrsg.) (2019): Theoretische Zugänge zur Pädagogik der frühen Kindheit. Eine kritische Vergewisserung, weinheim-Basel
Einsiedler W. (1994): Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels, Bad Heilbrunn
Fend H. (1990): Vom Kind zum Jugendlichen. Der Übergang und seine Risiken. Entwicklungspsychologie der Adoleszenz in der Moderne, Bd. 1, Bern-Stuttgart-Toronto?
Fölling-Albers? M./ Hopf A. (1995): Auf dem Weg vom Kleinkind zum Schulkind. Eine Langzeitstudie zum Aufwachsen in verschiedenen Lebensräumen, Opladen
Freericks R. - Hartmann R.- Stecker B.(2010): Freizeitwissenschaft. Handbuch für Pädagogik, Management und nachhaltige Entwicklung, München
Fröhlich-Gildhoff? K./ Nentwig-Gesemann? I./Neuß N. (Hrsg.) (2014): Forschung in der Frühpädagogik, Freiburg
Fthenakis W.E. (1993): Fünfzehn Jahre Vaterforschung im Überblick, in: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Was für Kinder. Aufwachsen in Deutschland. Ein Handbuch, München, 101-105
Gerries I.R.M. - De Brock A. JI.I.- Kentges-Kirschbaum? C. (1991): Ein systemisch-ökologisches Prozess-Modell? als Rahmenkonzept der Familienforschung, in: Psychologie in Erziehung und Unterricht 38/ 1991, 242-262
Geulen D. (1991): Die historisch Entwicklung sozialisationstheoretischer Ansätze, in: Hurrelmann K.- Ulich D. (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim - Basel, 21-56
Hebenstreit S.(1994): Kindzentrierte Kindergartenarbeit. Grundlagen und Perspektiven in Konzeption und Planung, Freiburg-Basel-Wien?
Helm J.- Schwertfeger A. (2015): Arbeitsfelder der Kinderpädagogik: eine Einführung, Weinheim - Basel
Huinink J.- Grundmann M. (1993): Kindheit als Lebenslauf, in: Markefka M.- Nauck B. (Hrsg.): Handbuch der Kindheitsforschung, Neuwied-Kriftel-Berlin?, 67-78
Joas H. (1991): Rollen-und Interaktionstheorien in der Sozialisationsforschung, in: Hurrelmann K.- Ulich D. (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim-Basel?, 137-152
Klewes J. (1983): Retroaktive Sozialisation: Einflüsse Jugendlicher auf ihre Eltern, Weinheim
Kohli M. (1991): Lebenslauftheoretische Ansätze in der Sozialisationsforschung, in: Hurrelmann K.- Ulich D.(Hrsg.): Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim-Basel?, 303-320
Kolip P. - Hurrelmann K.- Schnabel P.E. (Hrsg.) (1995): Jugend und Gesundheit. Interventionsfelder und Präventionsbereiche, Weinheim
Krenz A. (1994): Der "Situationsorientierte Ansatz" Im Kindergarten. Grundlagen und Praxis, Freiburg-Basel-Wien?
Kutter P. (1989): Moderne Psychoanalyse. Eine Einführung in die Psychoanalyse unbewusster Prozesse, München - Wien
Lazarus R.S.(1981): Stress und Stressbewältigung - Ein Paradigma, in: Filip S.H. (Hrsg.): Kritische Lebensereignisse, München-Wien-Baltimore?, 198-232
Mead G.H. (1968): Geist. Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus, Frankfurt/M.
Mertens W. (1991): Psychoanalytische Theorien und Forschungsbefunde, in: Hurrelmann K.-Ulich D. (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim - Basel, 77-98
Miller A. (1994): Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst. Eine Um- und Fortschreibung, Frankfurt/M.
Neuß N. (Hrsg.) (2013): Grundwissen Didaktik für die Krippe und Kindergarten, Berlin
Neuß N.- Kähler S. (Hrsg.) (2022): Grundwissen Kindheitspädagogik. Eine Einführung in Perspektiven, Begriffe und Handlungsfelder, Mühlheim an der Ruhr
Nickel H. (1995): Pränatale Psychologie aus ökologischer Perspektive. Plädoyer für ein noch immer vernachlässigtes Gebiet der Entwicklungspsychologie, in: Psychologie in Erziehung und Unterricht, 42.Jg., 77-81
Oerter R. (1993): Ist Kindheit Schicksal? Kindheit und ihr Gewicht im Lebenslauf, in: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Was für Kinder. Aufwachsen in Deutschland. Ein Handbuch, München 78-90
Oerter R. (1995): Kultur. Ökologie und Entwicklung, in: Oerter R.- Montada I. (Hrsg.): Entwicklungspsychologie, München-Weinheim?, 84-127
Oerter R. (1999): Psychologie des Spiels, München
Oerter R.- Montada L. (Hrsg.) (2008): Entwicklungspsychologie, Weinheim
Pasternak P. (2015): Die Teilakademisierung der Frühpädagogik. Eine Zehnjahresbeobachtung, Leipzig
Petermann F. (Hrsg.) (1993): Verhaltenstherapie mit Kindern, München
Petzold M. (1992): Familienentwicklungspsychologie. Einführung und Überblick, München
Piaget J.(1981): Das Weltbild des Kindes, Stuttgart
Piaget J. - Inhelder B. (1972): Die Psychologie des Kindes, Olten
Plake K. (2004): Handbuch Fernsehforschung - Befunde und Perspektiven, Wiesbaden
Rauh H. (1995): Frühe Kindheit, in: Oerter R.- Montada I. (Hrsg.): Entwicklungspsychologie, München-Weinheim?, 167-248
Sauerbrey U. (2021): Spielen in der frühen Kindheit. Grundwissen für den pädagogischen Alltag, Stuttgart
Schäfer G. - Staege R. - Meiners K. (Hrsg.) (2010): Kinderwelten - Bildungswelten. Unterwegs zur Frühpädagogik, Berlin
Schmidt-Denter? K. (1994) Soziale Entwicklung, München - Weinheim
Schneewind K.A. (1995): Familienentwicklung, in: Oerter R.- Montada I.(Hrsg.): Entwicklungspsychologie, Weinheim, 128-166
Schneewind K.A. (2010): Familienpsychologie, Stuttgart
Schwier J.- Seyde M. (Hrsg.) (2022): Bewegung, Spiel und Sport im Kindesalter. Neue Entwicklungen und Herausforderungen in der Sportpädagogik, Bielefeld
Stamm M.-Edelmann D. (Hrsg.) (2013): Handbuch frühkindliche Bildungsforschung, Wiesbaden
Stöbe-Blossey? S. (2010): Kindertagesbetreuung im Wandel. Perspektiven für die Organisationsentwicklung, Wiesbaden
Sünkel W. (2013): Erziehungsbegriff und Erziehungsverhältnis. Allgemeine Theorie der Erziehung, Weinheim-Basel?
Tillmann K.-J. (1994): Sozialisationstheorie. Eine Einführung in den Zusammenhang von Gesellschaft, Institution und Subjektwerdung, Reinbek bei Hamburg
Ulich D. (1991): Zur Relevanz verhaltenstheoretischer Lern-Konzepte? für die Sozialisationsforschung, in: Hurrelmann K. - Ulich D. (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim - Basel, 57-76
Verlinden M. (1995): Mädchen und Jungen im Kindergarten, Köln (Sozialpädagogisches Institut/ SPI)
Wiegand H.S. (1992): Piagets Entwicklungsbegriff und seine pädagogischen Konsequenzen - sechs Thesen zur Frühförderung, in: Kautter H. - Klein G.- Wiegand H.S.: Das Kind als Akteur seiner Entwicklung, Heidelberg, 143-173
Wittenbruch W. (1989): Erziehen in der Grundschule. Reflektierte Schulpraxis. Beiträge zur Lehrerfortbildung, Bochum
Zimmer G. (Hrsg.) (1981): Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit im Schulalter, Frankfurt/M.
Zinnecker I. (1990): Vom Straßenkind zum verhäuslichten Kind. Kindheitsgeschichte im Prozess der Zivilisation, in: Behnken I.(Hrsg.): Stadtgesellschaft und Kindheit im Prozess der Zivilisation, Opladen, 142-162
Einleitung  |  |
Das Interesse für den Bereich "Familie" und die damit verbundenen Aspekte ergibt sich aus den vielfältigen Fragen der Politischen Bildung und der Auseinandersetzung mit interkulturellen Phänomenen.
Ausgangspunkt der Überlegungen sind
- die Etablierung eigener Studiengänge im deutschsprachigen Raum, ausgehend von den USA und dem übrigen angelsächsischen Raum;
- die Absolvierung der Universitätslehrgänge "Politische Bildung" (2008) und "Interkulturelle Kompetenz" (2012) sowie der Weiterbildungsakademie Österreich (2010) und
- die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur.
- Wer sich mit der Sozialgeschichte Europas auseinandersetzt, stößt auf die Geschichte der Familie und erkennt, dass diese ein interessanter Bereich Politischer Bildung darstellt (vgl. KAELBLE 2007, 27-56).
Im Folgenden wird auf die Entwicklung von Familienwissenschaft, historische Merkmale von Formen und Beziehungen von Familien, Familienkonzepte im Bürgertum, Erscheinungsformen gegenwärtiger Familien, Familienpolitik und europäische Aspekte eingegangen.
Im Fokus stehen erziehungs- bzw. bildungswissenschaftliche Aspekte bzw. Elemente einer Politischen Bildung.
6 Einführung  |  |
Innerwissenschaftliche sozialwissenschaftliche Themenfelder als eigene Studiengänge sind eher selten. Ein neuer Themenbereich als angewandter Wissenschaftszweig ist mit Familienwissenschaft als Studiengang an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg seit dem Sommersemester 2013 eingerichtet (vgl. WEIDTMANN 2013).
1 Aus der Perspektive der Politischen Bildung bietet sich an, mit dem Phänomen Familie zu beschäftigen. Interdisziplinarität ist hier gefragt.
2 Interdisziplinarität wird seit der Bologna-Reform? in der Hochschullandschaft vermehrt praktiziert. Beispielhafte Studienformate entstanden etwa im Managementbereich, in European Studies, Ökonomie, Ökologie, Kulturwissenschaften und im Bildungsbereich (vgl. die vom Autor absolvierten Universitätslehrgänge in Salzburg und Klagenfurt; vgl. NEUE STUDIENGÄNGE AN DEUTSCHEN UNIS).
3 Vor- und Nachteile werden diskutiert, so etwa als "Studium light" und geringere Fundierung als ein Einzelstudiengang bzw. als Wissen mit gesteigerter Effizienz (Expertenwissen), übergreifenden Fachkenntnissen und Methodenkompetenz.
4 In den USA wächst die Zahl der interdisziplinären Studiengänge seit den neunziger Jahren deutlich (vgl. NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS 2013). Familienwissenschaft ist hier und im übrigen angelsächsischen Raum als "Family Science" oder "Family Studies" etabliert.
5 Sieht man sich die Entwicklung von Familienwissenschaften an, so erkennt man die sozialen und ökonomischen Veränderungen bereits mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Stadt-Land-Migration?, urbane Vorortentwicklungen, Kinderarmut, Gewalt, die Emanzipation der Frauen, veränderte Berufstätigkeiten, die Technisierung des Haushalts und erhöhte Anforderungen an die Bildung kennzeichnen Faktoren einer Entwicklung der Familienwissenschaft.
6 Als einer der Meilensteine der Entwicklung der Family Studies wird heute die Studie "The Family: A Dynamic Interpretation" (1938) von Willard WALLERS angesehen. Ernest GROVES hat den Prozess, Familienwissenschaften als interdisziplinäre Disziplin besonders vorangetrieben (vgl. GROVES 1946, 25-26).
Heute gibt es in den USA zahlreiche Studiengänge, besonders an den "State Universities". Mit dem Beitrag von Wesley BURR und Geoffrey LEIGH (1983) etablierte sich die Familienwissenschaft endgültig als eigenständige Disziplin mit einem interdisziplinären Forschungsfeld und eigenen Paradigmen, Methodologien und Aspekten.
Im deutschsprachigen Raum gibt es wenige Versuche einer Etablierung dieses Wissenschaftsbereichs. Man neigt eher zu Projekten und persönlichen Initiativen von Wissenschaftlern, so etwa die Interdisziplinäre Forschungsstelle Familienwissenschaft (IFF) an der Universität Oldenburg, das Interdisziplinäre Zentrum für Familienforschung an der Ruhr-Universität? Bochum und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ohne Lehre wie das Deutsche Jugendinstitut München (DJI) oder das Staatsinstitut für Familienforschung Bamberg (IFB). Gestrichen wurde der 2002 als Hertie-Stiftung? eingerichtete Stiftungslehrstuhl für Familienwissenschaft an der Universität Erfurt 2007.
Trotz des Bedarfs für eine Bearbeitung der Bedeutung von Familie, Familienprogrammen und Familieninstitutionen im nationalen und internationalen Bereich existiert kein eigenständiger Studiengang in Österreich (vgl. das Plädoyer von WINGEN 2004, 48). Bemerkenswert auch das Plädoyer von SCHWENZER und AESCHLIMANN (2006, 509-510).
Im deutschsprachigen Raum ergibt sich unter Beachtung der Politischen Bildung einen Forschungsstand,
- der mit Göran THERNBORN (2004) mit einem ausgezeichneten Überblick über die Familie im 20. Jahrhundert in Form einer Weltgeschichte angesetzt werden kann. Sinnvoll ist die Beschränkung auf die Aspekte des Patriarchalismus, der Heiraten und Fertilität.
- Andre BURGUIEREs Weltgeschichte der Familie (1996) und Philippe ARIES und Georges DUBYs "Geschichte des privaten Lebens" (1993) enthalten einzelne Kapitel europäischer Länder, umfassen aber nicht den letzten Teil des 20. Jahrhunderts.
- Der Überblick über die europäische Familie von Andreas GESTRICH, Michael MITTERAUER und Jens-Uwe? KRAUSE (2003) legt Schwerpunkte auch auf andere Epochen. Ein europäisches Gesamtbild erhält man auch nicht aus nationalen Überblicksdarstellungen (vgl. KAELBLE 2007, 28).
- Zu erwähnen sind die ausgezeichnete Geschichte der Frauen von Giesela BOCK (2000), die Geschichte der Kindheit von Egle BECCHI und Dominique JULIA (1998), die Geschichte der Mütter von Yvonne KNIEBIEHLER (2000) und die Geschichte der Unverheirateten von Jean Claude BOLOGNE (2004).
7 Historische Merkmale von Familienformen und Familienbeziehungen  |  |
Im Diskurs über heutige Familien mit ihren Leistungen spielen Vorstellungen über vergangene Familienverhältnisse eine Rolle. ROSENBAUM (1977) erkennt dies als wenig erstaunlich, weil die Besonderheit einer Situation erst dann erfasst wird, wenn man sie von einer davon abweichenden absetzt.
Bestimmend ist die Perspektive der Gegenwart.
7.1 Mittel- und Westeuropa  |  |
Die Eltern-Kind-Gruppe? in Mittel- und Westeuropa war nicht in große Verwandtschaftsverhältnisse eingebunden.
- Die Kleinfamilie war nicht das Ergebnis des Übergangs von einer vormodernen in die moderne Familie. Zudem spielten religiöse Gründe eine Rolle wie etwa das kirchliche Heiratsverbot mit Ehen zwischen Verwandten.
- Bestimmend ist ein Verwandtschaftssystem, dass keine der beiden Seiten der Ehepartner bevorzugt. Verwandt ist man mit allen Personen der mütterlichen und väterlichen Seite und bestimmt selbst die Präferenzen. Damit erhält die Kernfamilie eine zentrale Bedeutung.
- Bestimmend ist die Organisation von Arbeit seit dem 11. und 12. Jahrhundert in Form einer Familiarisierung, ergänzt ab dem Hochmittelalter mit Gesinde in Form von Inhabern von Höfen und Handwerksbetrieben. Schon durch die Betriebsgrößen, die zumeist nur eine Familie ernähren konnten, kam es eher selten zu größeren Familien mit mehreren Generationen. Typisch war dagegen die Beschäftigung von Personal, das in den Haushalt integriert war.
- Erst im 19. Jahrhundert stieg die Lebenserwartung und damit kam es häufiger zu einer Drei-Generationen-Familie?, wobei diese bei Bauern eher verbreitet war. Im mobilen Bürgertum lebten die Generationen weiter entfernt voneinander (vgl. ROSENBAUM 2014, 20-21).
Wer wen heiraten durfte, war sozial und obrigkeitlich kontrolliert. Heirat und Familiengründung waren abhängig vom Eigentum und Vermögen. Nicht-Besitzende? mussten ihre Befähigung nachweisen.
Von einer Heiratsbeschränkung besonders betroffen waren Angehörige einer unter-bäuerlichen Gruppe. Hier spielte auch der Charakter und der Lebenswandel eine Rolle.
Bis in das 19. Jahrhundert war die Heiratsbeschränkung ein Mittel zum Erhalt von Unterschichten. Eine Heirat blieb ein Privileg und Statussymbol von Besitzenden (vgl. LIPP 1982, 228-598). Mit der zunehmenden ökonomischen Entwicklung mit Manufakturen und Hausindustrie bzw. hausindustrieller Arbeit kam es zu verschiedensten Erwerbsmöglichkeiten und einer leichteren Familiengründung.
Für Angehörige der Unterschicht blieb mitunter die Alternative einer "wilden Ehe" (vgl. ROSENBAUM 2014, 30-32). Zudem galt sie als Alternative zur legitimen, kirchlich und weltlich anerkannten Ehe. Als Ledig-Sein? war der Staus vorgegeben, der für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen sowie für alle hausrechtlich Abhängige wie Gesinde, Lehrlinge und Gesellen galt.
Bis in das 19. Jahrhundert unterlagen auch Soldaten und Studenten einem Heiratsverbot (vgl. MÖHLE 1999, 193). Bis in das 19. Jahrhundert war Heirat ein Privileg, das von der Obrigkeit gewährt wurde. Die Genehmigung galt an den Nachweis des Bürgerrechts (Städte), die Erlaubnis der Heimatgemeinde und an den Nachweis von regelmäßigen Einnahmen oder Vermögen sowie den Lebenswandel und Charakter. Kirchliche Vorschriften je nach Konfession waren ebenso gültig (vgl. MÖHLE 1999, 188). Viele "wilde Ehe" waren Zweitbeziehungen. Mitunter entstanden komplexe Familienstrukturen.
In Krisenzeiten kam als letzte Möglichkeit eine Auswanderung in Betracht. Aus heutiger Sicht spielten materialistische Überlegungen eine Rolle.
Hinweise bestätigen, dass die Partnerwahl ohne Druck von außen stattfand. Die Akteure lebten in einem Umfeld, in dem sich gewisse soziale Muster entwickelten.
Pierre BOURDIEU (1993, 285) hat bäuerliche Heiratsstrategien in einem Kontext an die Wahrnehmung der Lebenserfahrung gesehen. Früheste Erziehung wird durch soziale Erfahrungen mit Wahrnehmung und Beurteilung verstärkt ("Vorlieben"), die auch für potentielle Partner gelten. Solche Wahrnehmungsmuster sind Ähnlichkeitswahlen, die auch heute unter anderen Bedingungen gelten (vgl. GESTRICH 2003, 503-504).
Das Heiratsalter hing von lokalen und regionalen Arbeitsmöglichkeiten und Einkommensverhältnissen ab.
Auch bestimmten Qualifikationsschritte eine Heirat, man denke nur an Handwerker mit der Bedingung der Meisterprüfung für eine Betriebsführung. Altersungleiche Ehen ergaben sich aus der Verbindung zwischen Meisterwitwen und Gesellen (vgl. ROSENBAUM 1982, 151).
7.2 Verhältnis der Ehepartner  |  |
Das Verhältnis der Ehepartner wurde durch gemeinsame Arbeit und Verantwortung für den Betrieb geprägt. Feste Vorstellungen für die Arbeitsbereiche von Frauen und Männern regelten den Alltag.
Es galt gesellschaftlich normiert, dass der Mann die Arbeiten außerhalb des Hauses, die Frau die Arbeiten im und um das Haus mit der Sorge um die Kinder zu leisten hatten.
Im kleinbäuerlichen Betrieb hatte die Frau am Feld mitzuarbeiten. Jedenfalls konnte man von einem Statusvorsprung des Mannes mit einer patriarchalischen Ordnung, auch in ökonomischer und öffentlicher Funktion, sprechen (vgl. ROSENBAUM 2014, 25-26). Im Handwerk überwachte die Zunft die Einhaltung der Arbeitsteilung. Mitunter waren die Ehebeziehungen konfliktreich, weil bei den beengten Arbeits- und Lebensverhältnissen Rückzugsräume kaum vorhanden waren (vgl. ROSENBAUM 1982, 153-155). Dies betraf damit auch die ehelichen sexuellen Beziehungen, die wenig Intimität zuließen. ILIEN und JEGGLE (1978, 80) verweisen auf den Zusammenhang mit der Existenzsicherung (Härte der Arbeit, Hunger, mangelhafte Räumlichkeiten). Vor- und außereheliche Beziehungen bestanden heimlich und im Verborgenen und hatten den Makel der Sünde (vgl. ROSENBAUM 2014, 26).
In der Regel gab es mehr Schwangerschaften als überlebende Kinder (hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit). Durch Fehl- und Totgeburten bzw. frühe Kindersterblichkeit - bedingt durch hygienische Verhältnisse, bestimmte Traditionen der Säuglingsernährung und Arbeitsbelastung der Mütter - kam es zu großen Altersabständen in der Geschwisterreihe. Die Notwendigkeit einer Wiederverheiratung beim Tod eines Ehepartners führte zu Halb- und Stiefgeschwistern (vgl. ROSENBAUM 1982, 212-214; GESTRICH 2003, 567-569).
7.3 Stellung der Kinder  |  |
Kinder standen wenig im Interesse und der Aufmerksamkeit der Erwachsenen. Entsprechend ihrem Alter wurden sie in den Alltag integriert. Mit zunehmendem Alter trat die Arbeit in den Vordergrund (Nachahmung - Rollenübernahme - Anerkennung). Bezugspersonen waren die Eltern, Großeltern und die Arbeitskräfte im Betrieb. Unter Umständen waren es auch Nachbarn.
Befehl und Gehorsam sowie körperliche Strafen waren selbstverständlich. Die Schule spielte kaum eine Rolle.
Mit der Schulpflicht kam es zur Übernahme der Arbeitspflicht. Die Jungen verließen bald das Elternhaus. Mädchen blieben allgemein länger - zur Hausarbeit - an das Haus gebunden.
8 Familienkonzepte des Bürgertums  |  |
8.1 Trennung Familie - Berufstätigkeit  |  |
Mit der Trennung von Familie und Berufstätigkeit bzw. Familie und Erwerb entstanden neue Vorstellungen über Ehe und Familie (vgl. ROSENBAUM 1982, 251-253, 271-273).
Wesentliche Aspekte waren nunmehr
- mehr Zuneigung und Liebe und weniger sachliche Erwägungen als Ideal als Austausch von Gedanken und Gefühlen,
- eine veränderte Einstellung zu Kindern mit Zuneigung und
- einer Abgrenzung der Familie als Einheit nach außen, damit ein Entstehen von Privatsphäre.
Diese Aspekte ergaben sich aus dem entstandenen Bürgertum, das sie auch erst versuchte zu realisieren. In der Monarchie gehörten zum Bürgertum Unternehmer, Freiberufler, höhere Beamte und materiell abgesicherte sonstige Berufe.
Erziehung und Bildung waren im Bürgertum wesentlich, bei Frauen ein wesentlicher Aspekt für eine Ehe. Ein Leben als Unverheiratete war nicht erstrebenswert. Für Männer gehörte die Ehe und Familie zu einer bürgerlichen Existenz. Eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ergab für die Frau den Haushalt und die Kindererziehung, für den Mann das Berufsleben und die Öffentlichkeit mit einer rechtlichen innerfamiliären Autorität und Entscheidungsbefugnis (vgl. ROSENBAUM 1982, 343).
Im Bürgertum hatten Kinder als Arbeitskräfte keine Bedeutung. Unterricht und Erziehung vollzogen sich in Schule bzw. häuslicher Umgebung. Die Bedeutung ergab sich aus der familiären Situation (Partnerwahl) und der Wertschätzung von Bildung. Dies war eine gemeinsame Aufgabe der Eltern und wurde finanziell unterstützt (vgl. ROSENBAUM 1982, 364-365).
Hilfreich war in dieser Entwicklung auch der Rückgang der Kinderzahlen, resultierend aus der zunehmend wertschätzenden Haltung der Gesundheit von Frauen und hohen Ausbildungskosten für Kinder (vgl. GESTRICH 2003, 513-515).
Kennzeichnend war die Arbeitsteilung, die Frau als Mutter und Leiterin des Personals, der Mann als Vater und Betriebsinhaber, als Randfigur bei der Erziehung der Kinder. Söhne wurde in der Regel mehr gefördert, wollte man doch den sozialen Staus der Familie zumindest halten. Töchter erhielten keine Ausbildung zur selbständigen Lebensführung, vielmehr stand eine Haushaltsführung und gesellschaftliche Konventionen für eine spätere Ehe im Mittelpunkt.
Bedingungen für eine Bildung der bürgerlichen Familie waren demnach die Trennung zwischen Familie und Arbeit sowie eine gesicherte materielle Situation. Hier lag der Unterschied zum Familienmodell der Arbeiterschaft und des Kleinbürgertums.
Erst mit den Bemühungen um eine Verbesserung der ökonomischen Situation und der Bildung von Qualifikationen in der Arbeiterschaft und bei Angestellten realisierte sich das bürgerliche Familienmodell.
9 Erscheinungsformen gegenwärtiger Familien  |  |
Ausgehend von der Definition, dass mit "Familie" die in einem Haushalt lebende Gruppe aus einem oder mehreren Erwachsenen mit Kind bzw. Kindern bezeichnet wird, zeigt es sich, dass Familien im Vergleich zur angeführten historischen Entwicklung vermehrt als Kleinfamilien leben (vgl. ROSENBAUM 2014, 36).
Realisiert wird dies durch
- getrennte Haushalte,
- eine veränderte Position der Frauen,
- Bildungsgleichheit von Söhnen und Töchtern,
- Erwerbstätigkeit von Frauen, auch bei kleinen Kindern und
- gleichbleibender Arbeit im Haushalt (vgl. PFAU-EFFINGER? 2000; ROSENBAUM 2014, 36).
Klassen- und Schichtzugehörigkeit spielen nach wie vor eine Rolle, wie es sich bei der Partnerwahl zeigt ("Kulturkapital" als Merkmal, vgl. dazu GESTRICH 2003, 498, 503-504).
Zur Diskussion stehen
- die hohe Quote der Wiederverheiratungen bzw. neue Partnerschaften,
- die komplexen Familien- und Verwandtschaftsstrukturen (vgl. STEINBACH 2008, 153-180),
- nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit oder ohne Kinder (vgl. diese als Nachfolge von "wilden Ehen") und
- damit andere Perspektiven als etwa Folgen einer frühen Verwitwung.
- Trennung und Scheidung besitzen andere Emotionalität und Belastungen als schlechte soziale Umstände und Armut.
- Ehe und Familie ist kein Privileg mehr, mitunter sehen Menschen in ihr nur mehr eine unnötige Formalität.
Privilegiert ist die Ehe (nur) durch die staatliche Verfassung und das Steuerrecht. Kirchenrechtliche Vorschriften werden unterschiedlich gesehen und ergeben einen privaten Charakter.
10 Familienpolitik  |  |
Im Folgenden geht es um politische Elemente der Gerechtigkeit und des Nachteilausgleichs, der Effizienz von Maßnahmen und der Nachhaltigkeit.
Abschließend soll Familienpolitik im europäischen Kontext diskutiert werden.
10.1 Gerechtigkeitsregeln - Nachteilsausgleich  |  |
Mit der Änderung der Familienverhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es zu einer Diskussion um die Stellung der Familie in einer demokratischen Gesellschaft.
- Es geht grundsätzlich um die Stärkung der Familien, der Elternrechte, die Erziehung der nachwachsenden Generation, die innerfamiliären Beziehungen und aktuell um integrative Maßnahmen von zugezogener Familien. Es geht auch um einen Abbau der patriarchalen Stellung autoritärer Väter als Ursache autoritärer Charakterstrukturen (vgl. ADORNO/FRENKEL-BRUNSWICK?/LEVINSON/SANFORD 1950; HENTSCHKE 2001; BERTRAM-DEUFLHARD? 2014, 327-328).
- Es geht um den verfassungsgemäßen Schutz von Ehe und Familie.
- Es geht um die Erziehung und Pflege der Kinder als Recht und Pflicht der Eltern.
- Erziehungsberechtigung bedeutet nur dann einen Eingriff des Staates, wenn diese versagt oder Verwahrlosung droht.
- Mütter haben den Anspruch auf Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft.
- Die Gesetzgebung verschafft unehelichen Kindern die gleichen Bedingungen für ihre Entwicklung und gesellschaftliche Stellung wie den ehelichen.
- Der Staat wacht über die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten und besitzt das Recht einzugreifen.
- Unabhängig von der Lebensform gibt es die Fürsorge- und Erziehungspflicht der Eltern bzw. des/der Erziehungsberechtigten.
- Familienpolitik steht in enger Verbindung mit Sozial-, Frauen-, Bildung-, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik.
- Nicht nur die Regierung und das Parlament sind in der Pflicht, auch die Rechtsprechung und völkerrechtliche Grundrechte schützen die "Familie", d.h. das Familienleben, das Recht auf Gründung einer Familie, das Erziehungsrecht, das Umgangsrecht der Kinder mit den Eltern bzw. der Eltern mit den Kindern und der rechtliche und wirtschaftliche Schutz von Familien einschließlich des Anspruchs auf Mutterschafts- und Elternurlaub steht unter einem besonderen Schutz.
- Dies zeigt sich etwa in der Grundrechtscharta der EU 2010 in den Kapiteln 7,9,14,24 und 33.
Angesichts des umfassenden parlamentarischen und rechtlichen Rahmens versteht es sich von selbst, dass es ein eigenes Familienministerium gibt.
Familienpolitik, Sozialpolitik und Frauenpolitik ist hier gekennzeichnet durch Gerechtigkeitsregeln und einen Nachteilsausgleich.
In diesem Konzept spielt der Interessensausgleich der Eltern und Kinder eine wesentliche Rolle.
Damit ist die Gleichberechtigung der Ehepartner angesprochen (vgl. beispielhaft in der Erziehung und Arbeitswelt; siehe die IT-Autorenbeiträge?  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erziehung, Vorberufliche Bildung in Österreich, Gender). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erziehung, Vorberufliche Bildung in Österreich, Gender).
10.2 Effizienz von Maßnahmen - Neoliberalismus  |  |
Familienpolitische Ziele ergeben sich hier
- in der Stärkung der wirtschaftlichen Stabilität von Familien,
- der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- dem Wohlergehen der Kinder und einer positiven Entwicklung der Fertilität.
- Damit soll es zu einer Stärkung und Entwicklung des Humanvermögens kommen (vgl. die wirtschaftlich selbständige Familie und die eigenständige Fürsorgeleistung für ihre Kinder; BERTRAM-DEUFLHARD? 2014, 333).
Man hat ebenfalls in diesem Kontext zu bedenken, dass die Frage einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf sich bei einer allleinerziehenden Mutter anders darstellt als bei einer Familie mit Mutter und Vater oder bei einer Familie mit mehreren Kindern.
Umstritten ist ebenfalls die Fertilitätsrate, wie hoch sie für die Sicherung des Humanvermögens der Gesellschaft sein sollte und in welcher Form überhaupt ein Einfluss der Familienpolitik anzunehmen ist (vgl. LUTZ 2008,17-24; GAUTHIER 2007, 323-346).
Plädiert wird für die Umsetzung von Teilzielen familienpolitischer Maßnahmen und Annahmen für die Wirkung dieser Ziele. "Denn Mütter und Väter haben auch unabhängig von ihren unterschiedlichen Qualifikationen in ihrer Sozialisation bestimmte Präferenzen entwickelt, die die Wirkung von Maßnahmen in erheblichem Umfang beeinflussen können" (BERTRAM-DEUFLHARD? 2014, 334).
Zudem spielen geschlechtsspezifische Sozialisationserfahrungen eine Rolle. Man denke nur an die Tendenz in Europa, dass Mütter Kinder und Beruf als Lebensziel mit der Präferenz für Kinder ansehen, während Väter dem Beruf ein höheres Gewicht geben. In der Praxis wird auf solche Differenzierungen verzichtet. Es kommt eher zu Generalisierungen, etwa erhöhte Kinderleistungen lassen erhöhte Kosten beim Staat entstehen, es kommt zu verringerten Arbeitszeiten von Müttern. Daher kommt es zu geringeren Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträgen (Reduzierung auf das ökonomische Prinzip).
Der Neoliberalismus unterstellt, dass das menschliche Wohlbefinden dann am größten ist, wenn die Gesellschaft allein durch den Markt reguliert wird. Die staatliche Aufgabe ist daher auf die Herstellung einer Marktfreiheit begrenzt. Es kommt zur paradoxen Annahme, dass das Wohlbefinden der Familie und ihrer Mitglieder dann maximiert wird, wenn sie zunehmend individuell marktabhängig sind. Dem Staat fällt in diesem Modell keine Rolle zu, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Familien ihre Freiheit auch leben können (vgl. BERTRAM-DEUFLHARD? 2014, 335-336).
Im internationalen Vergleich sind die Annahmen über Wirkungen familienpolitischer Maßnahmen umstritten. ADEMA (2012, 487-498) weist im OECD-Vergleich? darauf hin, dass Mütter mit mehreren Kindern in allen OECD-Ländern? eine geringere Arbeitszeit aufweisen als Mütter mit einem Kind (vgl. Skandinavien, UK und die USA, auch die EU-Staaten? im Süden und F). Der Zeitrahmen hängt wesentlich von Alter und der Zahl der Kinder ab.
Es zeigt sich das Dilemma, dass eine neoliberale Familienpolitik die Perspektive der Präsenz der Eltern am Arbeitsmarkt mit Verbesserungen vorrangig betrachtet.
Es wird also deutlich, dass die Wirkung von familienpolitischen Maßnahmen ohne die Berücksichtigung individueller Präferenzen und Lebensentwürfe der Eltern an der Realität der Eltern vorbeigeht (vgl. BERTRAM-DEUFLHARD? 2014, 337).
10.3 Nachhaltige Familienpolitik  |  |
Mit der Einflussnahme von US-Vorstellungen? auf die Familienpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, zunächst in Deutschland, folgen Konzepte der OECD mit einer Fülle internationaler Vergleiche zu familienpolitischen Leistungen.
Wesentlich scheint die Erkenntnis, dass nationale Familienpolitik die Basis von internationalen Vergleichsdaten benötigt.
Der Wandel der familiären Lebensformen, alleinerziehende Eltern (-teile), die Konzentration bestimmter Migrantengruppen in bestimmten Regionen, eine zunehmende berufliche Qualifikation von Müttern mit Kindern, ein Wandel ökonomischer Strukturen und der Rückgang der Kinderzahlen sind nicht nur nationale Merkmale.
Europäische Länder führen ebenfalls diese Diskussionen, eine internationale Perspektive erleichtert den Diskurs. Dies ist wichtig, weil die kulturell unterschiedlichen Entwicklungen in einzelnen Ländern die Möglichkeit ergibt, Stärken und Schwächen von familienpolitischen Maßnahmen zu prüfen.
Thesen wie die Erhöhung des Kindergeldes bzw. der Familienbeihilfe würden bei schlecht Qualifizierten niedrig bezahlte Arbeit aufgeben, lässt sich ebenso prüfen wie etwa die These, eine größere Präsenz am Arbeitsmarkt verringere die Kinderarmut.
Zudem hat die EU-Grundrechtscharta? 2010 eine klare rechtspolitische Struktur geschaffen, mit der nationale Familienpolitik sich in den einzelnen Ländern zu bewegen hat (Schutz der Familie, Mutterschutz, Elternurlaub, Erziehungsrecht; vgl. BERTRAM-DEUFLHARD? 2014, 339-340). Damit wird festgestellt, dass ein Mitgliedsstaat der EU sehr wohl Familienpolitik auf die gleichen Grundlagen aufbauen kann, die in anderen EU-Staaten? gelten /vgl. MITTERAUER 2003).
10.4 Familienpolitik im europäischen Kontext  |  |
Die knappen Prinzipien einer nachhaltigen Familienpolitik zeigen an, dass Neudefinitionen bzw. neue Überlegungen notwendig werden.
Horizontale Gerechtigkeit sollte das klassische Modell eines sozialen Ausgleichs sicherstellen. Eltern sollen finanziell gegenüber Nicht-Eltern? nicht benachteiligt werden. Eine Gesellschaft kann erwarten, dass Mütter und Väter gleichberechtigt ihre Existenz sichern, sie kann aber auch erwarten, falls noch zusätzlich die Existenz des Kindes gesichert ist (vgl. das Leistungsprinzip und Sozialprinzip).
Gleichberechtigung von Frauen und Männern - kodifiziert in der Bundesverfassung und EU-Charta? 2010 - ist nur dann realisierbar, wenn eine Familienpolitik sicherstellen kann, dass Fürsorge- und Erziehungsleistung für Kinder und den Lebensvorstellungen der Eltern mit ihrem Können und vermögen am Arbeitsmarkt in den einzelnen Altersphasen des Kindes eine Balance hergestellt wird. Diese "Work-Life-Balance?" beinhaltet eine Sicherstellung von Kinderkrippen bis zu infrastrukturellen Angeboten für Kinder und Heranwachsende.
Nachhaltige Familienpolitik wäre in einem Irrtum zu glauben, dass ein solcher Ausbau ausreichend wäre, um die Entwicklung von Kindern und Heranwachsenden sicher zustellen. Ein solcher Prozess benötigt nicht nur institutionelle Orte und die Familie, vielmehr wird er auch positiv durch kommunale und soziale Einrichtungen und dem Elternhaus so gestaltet, dass zu Erziehende im unmittelbaren Nahbereich positive Erfahrungen sammeln können.
Gefordert ist eine konsequente Ablehnung von familialer Gewalt und damit einer Förderung familialer Erziehung und konsequenter Unterstützung familialer Bindung (vgl. SCHREIBER 2015, 162-171).
Gefordert sind Impulse bzw. Initiativen der Bildungs-, Gesundheits-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.
Für Randgruppen und Zuwanderer spezifische Angebote sind vermehrt einzufordern (vgl. die entsprechenden IT-Autorenbeiträge?  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Vorberufliche Bildung in Österreich; Migration in Österreich 1,2; Interkulturelle Kompetenz; REICH 2014). Soziale Gerechtigkeit wird hier erweitert. http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Vorberufliche Bildung in Österreich; Migration in Österreich 1,2; Interkulturelle Kompetenz; REICH 2014). Soziale Gerechtigkeit wird hier erweitert.
Fürsorge für andere kostet Zeit. Diskriminierungen ergeben sich, wenn man sich ausschließlich am Muster beruflicher Karrieren orientiert (vgl. die Bemühungen um eine vermehrte Bedeutung und Unterstützung von Freiwilligentätigkeiten/"Ehrenamtlichkeit" und deren Notwendigkeit einer Koordination > DICHATSCHEK 2012/2013, 688-692).
Die größte Herausforderung von Familienpolitik für die Zukunft dürfte wohl bei der Fürsorge für Kinder und Ältere darin bestehen, die die Lebensverläufe und ihre Fürsorgeleistungen zu keinen Benachteiligungen kommen zu lassen. Erst bei einer vielgestaltigen Organisation der Lebensverläufe ist eine soziale Gerechtigkeit nach dem Verständnis von Nachhaltigkeit erreicht.
Für die Bildungseinrichtungen gelten in jedem Fall, dass Voraussetzungen und Standards, entsprechende Elemente, Methoden und Unterrichtsplanungen sowie Qualitäten einer Inklusion dringend einzufordern sind (vgl. REICH 2014). Damit ist auch der gesamtgesellschaftliche Rahmen abzustecken.
11 Europäische Aspekte  |  |
WALL, LASLETT und MITTERAUER haben die die These einer "europäischen Familie" entwickelt (vgl. MITTERAUER 2004, 140-160; KAELBLE 2007, 52-53).
Kernaussagen sind die Gründung eigener Haushalte jung verheirateter Ehepaare, ein höheres Heiratsalter, niedrigere Geburtsraten und berufliche Selbständigkeit sowie
eine höhere Zahl lebenslang Unverheirateter.
Bestimmte Lebensweisen ergeben sich in der Intimität der Familie, dem Ideal der Liebesheirat, der emotionalen Bindung in der Eltern-Kinder-Beziehung?, der Verantwortung für die Erziehung durch die Eltern, der starken Orientierung der Kinder an die Eltern und der Vorbereitung einer Trennung von der Herkunftsfamilie in der Jugend etwa durch eine starke Pubertätskrise, den Eintritt in ein Internat, die berufliche Stellung als Lehrling bzw. Bedienstete und der Militärdienst (vgl. MITTERAUER 1986).
Bis zum 19. Jahrhundert gab es diese Entwicklung im nördlichen und westlichen Europa, erst ab dem 19. Jahrhundert entwickelt sich diese Familienkonstellation in ganz Europa allmählich aus.
Eine europäische Besonderheit entstand in der Vielfalt der Ehe- und Familienmodelle.
Die Scheidungsraten stiegen, blieben aber unter der US-Rate? und waren höher als in Asien (einschließlich der modernen Gesellschaften in Japan, Singapur, Korea und Honkong; vgl. KAELBLE 2007, 54).
Ebenso war bzw. blieb eine Besonderheit die Ein-Eltern-Familie? (vgl. das Extrembeispiel Dänemark).
Außereheliche Geburten blieben in Europa niedriger als in den USA, höher aber als in Asien (vgl. COLEMAN 2002, 319-344).
Zusammenfassend kann man feststellen, dass es zwar unübersehbare Unterschiede und Verschiedenheiten in Europa gibt, daneben aber auch spürbare Annäherungen und bestimmte Eigenarten der europäischen Familie, die sie deutlich von außereuropäischen Familienkonzepten unterscheiden (vgl. KAELBLE 2007, 54).
Literaturverzeichnis II  |  |
Angeführt sind diejenigen Titel, die für den Beitrag verwendet und/oder direkt zitiert werden.
Adorno Th./Frenkel-Brunswik E./Levinson D.J./Sanford R.N. (1950): The Authoritarian Personality Studies in Prejudice Series, Vol. 1, New York
Angell R.C. (1936): The Family Encounters the Depression, New York
Aries R.-Duby G. (1993): Geschichte des privaten Lebens, Bd. 5: Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Frankfurt/M.
Becchi E.-Julia D. (Hrsg.) (1998): Histoire de l' enfance en occident, Paris
Bertram H.-Deuflhard C. (2014): Familienpolitik gerecht, neoliberal oder nachhaltig?, in: Steinbach A.-Hennig M.-Becker O.A. (Hrsg.): Familie im Fokus der Wissenschaft, Wiesbaden, 327-352
Bock G. (2000): Frauen in der Europäischen Geschichte, München
Bologne J.C. (2004): Histoire du celibat et des celibataires, Paris
Bourdieu P. (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt/M.
Burguiere A. (1996): Geschichte der Familie, 4 Bd., Frankfurt/M-New Yoprk
Burr W.R.-Leigh G.K. (1983): Famology - A New Discipline, in: Journal of Marriage and the Family 45/3, 467-480
Coleman D.A. (2002): Populations of the industrial world - a covergent demographic community?, in: International journal of population geography 8/2002, 319-344
Dichatschek G. (2012/2013): Ehrenamtlichkeit in der Erwachsenenbildung, in: Amt und Gemeinde 20102/2013, Heft 4, 688-692
Gauthier A.H. (2007): The impact of family policies on fertility in industrialized countries, a review of literature, in: Population Research and Policy Review 26/2007, 323-346
Gestrich A. (1999): Geschichte der Familie im 19. und 20. Jahrhundert, München
Gestrich A. (2003): Neuzeit, in: Gestrich A.-Krause U.-Mitterauer M. (Hrsg.): Geschichte der Familie, Stuttgart, 364-652
Gestrich A./Krause J.-U./ Mitterauer M. (2003): Geschichte der Familie, Stuttgart
Groves E. (1946): Professional Training for Family Life Educators, in: Marriage and Family Living 8, 25-26
Hentschke F. (2001): Demokratisierung als Ziel der amerikanischen Besatzungspolitik in Deutschland und Japan 1943-1947, Münster
Ilien A.-Jeggle U. (1978): Leben auf dem Dorfe. Zur Sozialgeschichte des Dorfes und zur Sozialpsychologie seiner Bewohner, Opladen
Kaelble H. (2007): Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart, Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 618, Bonn
Kniebiehler Y. (2000): Histoire des meres et de la maternite en occident, Paris
Lipp C. (1982): Dörfliche Formen generativer und sozialer Reproduktion, in: Kaschuba W.-Lipp C. (Hrsg.): Dörfliches Überleben, Tübingen, 228-598
Lutz W. (2008): Demographic Debate. What should be the Goal of Population Policies? Focus in "Balanced Human Capital Development", in: Vienna Yearbook of Population Research 2008, 17-24
Mitterauer M. (1986): Sozialgeschichte der Jugend, Frankfurt/M.
Mitterauer M. (2003): Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs, München
Mitterauer M. (2004): A European Family in the 19th and 20th centuries?, in: Kaelble H. (Hrsg.): The European Way. European Societies during the 19th and 20th centuries, New York
Mitterauer M. (2013): Historische Verwandtschaftsforschung, Wien-Weimar-Köln?
Möhle S. (1999): Nichteheliche Lebensgemeinschaften in historischer Perspektive, in: Klein T.-Lauterbach W. (Hrsg.): Nichteheliche Lebensgemeinschaften. Analysen zum Wandel partnerschaftlichen Lebensformen, Opladen, 183-204
National Center for Educational Statistics/NCES (2013): Undergraduate Fields of Study >  http://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_cta.pdf (7.1.2015) http://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_cta.pdf (7.1.2015)
Neue Studiengänge an deutschen Unis, in: Wissen.de >  http://www.wissen.de/neue-studiengaenge-deutschen-unis (7.1.2015) http://www.wissen.de/neue-studiengaenge-deutschen-unis (7.1.2015)
Pfau-Effinger? B. (2000): Kultur und Frauenerwerbstätigkeit in Europa. Theorie und Empirie des internationalen Vergleichs, Opladen
Reich K. (2014): Inklusive Didaktik, Weinheim-Basel?
Repko A.F. (2012): Interdisciplinary Research. Process and Theory, Los Angeles
Rosenbaum H. (1977): Die Bedeutung historischer Forschung für die Erkenntnis der Gegenwart - dargestellt am Beispiel der Familiensoziologie, in: Lüdtke A.-Uhl H.(Hrsg.): Kooperation der Sozialwissenschaften, Bd. 2, Stuttgart, 178-203
Rosenbaum H. (1982): Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammenhang von Familienverhältnissen, Sozialstruktur und sozialem Wandel in der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Frankfurt/M.
Rosenbaum H. (2014): Familienformen im historischen Wandel, in: Steinbach A.-Hennig M.-Becker O.A. (Hrsg.): Familie im Fokus der Wissenschaft, Wiesbaden, 19- 39
Schreiber H. (2015): Familiale Gewalt in der Erziehung, in: Schreiber H.-Jarosch M.-Gensluckner L.- Haselwanter M.- Hussl El. (Hrsg.): Gaismair-Jahrbuch? 2016. Zwischentöne, Innsbruck-Wien-Bozen?, 162-171
Schwenzer I.-Aeschlimann S. (2006): Zur Notwendigkeit einer Disziplin "Familienwissenschaft", in: Dubs R.-Fritsch B.-Schambeck H.-Seidl E.-Tschirky H. (Hrsg.): Bildungswesen im Umbruch. Festschrift zum 75. Geburstag von Hans Giger, Zürich, 501-511
Steinbach A. (2008): Stieffamilien in Deutschland. Ergebnisse des "Generations and Gender Survey" 2005, in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 33/2008, 153-180
Steinbach A.-Henning M.-Becker O.A. (Hrsg.) (2014): Familie im Fokus der Wissenschaft, Wiesbaden
Thernborn G. (2004): Between sex and power. Family in the world, 1900-2000, London
Wallers W. (1938): The Family: A Dynamic Interpretation, New York
Weidtmann K. (2013): Angewandte Familienwissenschaft. Der neue Weiterbildungs-Master? an der Fakultät W&S ist zum Sommersemester 2013 gestartet, in: standpunkt: sozial 2/2013, 81-86
Wingen M. (2004): Auf dem Weg zur Familienwissenschaft. Vorüberlegungen zur Grundlegung eines interdisziplinären Fachs, Berlin
IT-Autorenbeiträge/Auswahl?  |  |
Die folgenden Hinweise auf IT-Autorenbeiträge? gelten als Ergänzung zum Beitrag.
Netzwerk gegen Gewalt >  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index:
Aspekte von Gewalt
Projekt Gewalt in der Schule
Gleichbehandlung und Diskriminierung in der EU
Gewaltprävention in der Erziehung
Politische Bildung
Globales Lernen
Interkulturelle Kompetenz
Migration in Österreich 1,2
Schule
Erziehung
Gender
Vorberufliche Bildung in Österreich
Erwachsenenbildung
E-Plattform? für Erwachsenenbildung in Europa/EPALE
 https://ec.europa.eu/epale/de/resource-centre/content/netzwerk-gegen-gewalt https://ec.europa.eu/epale/de/resource-centre/content/netzwerk-gegen-gewalt
Zum Autor  |  |
APS-Lehramt? VS, HS und PL (1970, 1975, 1976), zertifizierter Schüler- und Schulentwicklungsberater (1975, 1999), Lehrbeauftragter am PI des Landes Tirol/ Berufsorientierung und Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für die APS beim Landesschulrat für Tirol (1993-2002)
Lehrbeauftragter am Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft der Universität Wien/Berufspädagogik/Aus- und Weiterbildung/ Vorberufliche Bildung (1990/1991-2010/2011), Lehrbeauftragter am Sprachförderzentrum des Stadtschulrates für Wien/Interkulturelle Kommunikation (2012), Lehrbeauftragter am Fachbereich für Geschichte der Universität Salzburg/Lehramt für Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung - Didaktik der Politischen Bildung (2015/2016, 2018)
Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche in Österreich A. und H.B. (2000-2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks in Tirol (2004-2009, 2017-2019), Lehrender an den Salzburger VHSn Zell/See, Saalfelden und Stadt Salzburg (2012-2019)
Absolvent des Instituts für Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg-Klagenfurt?/ Master (2008), des 7. Universitätslehrganges Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012), der Weiterbildungsakademie Österreich/ Diplome (2010), der Personalentwicklung für Mitarbeiter der Universitäten Wien/ Bildungsmanagement/ Zertifizierung(2008-2010) und Salzburg/ 4. Interner Lehrgang für Hochschuldidaktik/ Zertifizierung (2015/2016), des Fernstudiums Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium - Comenius Institut Münster/Zertifizierung (2018)
Aufnahme in die Liste der sachverständigen Personen für den Nationalen Qualifikationsrahmen/NQR, Koordinierungsstelle für den NQR/Wien (2016)
 MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net
Anhang  |  |
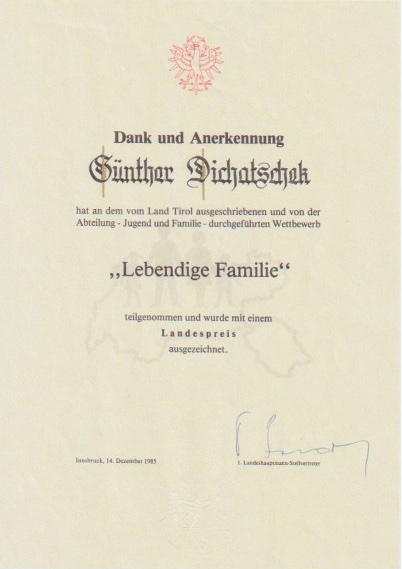
|