|
Grundwissen Historische Politische Bildung
Veränderung (letzte Korrektur)
(Autor, Normalansicht)
Verändert: 438c438
Stadium 2: Naiv-egoistische Orientierung
|
Stadium 2: Naiv - egoistische Orientierung
|
Grundwissen Historische Politische Bildung 1  |  |
Elemente einer sozio - historischen Entwicklung in einer vernachlässigten Disziplin  |  |
Günther Dichatschek
 | | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |
|
|
Politische Bildung initiiert und organisiert Bildungsprozesse, in denen es darum geht, unser individuelles Verhältnis zum Politischen zu bestimmen. Ihr liegt die Annahme zugrunde, dass Demokratinnen und Demokraten nicht einfach geboren werden, Demokratie vielmehr von Generation zu Generation neu erlernt werden muss.
Politische Bildung ist allerdings nur eine Instanz politischer Sozialisation neben anderen. Sie steht in Konkurrenz zu weiteren Einflussfaktoren oder wirkt mit diesen zusammen. Etwa formen auch Medien, Parteien und das direkte soziale Umfeld die politischen Einstellungen und Entscheidungen jedes Einzelnen. Zahlreiche, weltanschaulich unterschiedlich ausgerichtete Institutionen tragen heute die politische Bildung. Über Jahrzehnte sind Strukturen der Selbstorganisation und Selbstreflexion gewachsen.
Eine eigene Fachwissenschaft konnte sich etablieren, die laufend Debatten über Ziele, über die Auswahl von Inhalten und Handlungsfeldern, sowie über die Begründung von Prinzipien und Methoden führt. Im Ganzen eine im Vergleich zu anderen Ländern reichlich komplexe Professionslandschaft.
Die Studie bietet eine orientierende Einführung für jene, die sich für eine historische politische Bildung interessieren.
IT - Hinweis
 https://www.bpb.de/lernen/politische-bildung/ (6.4.2025) https://www.bpb.de/lernen/politische-bildung/ (6.4.2025)
Teil I Allgemeiner Teil  |  |
1 Historische Kompetenzen  |  |
1.1 Historische Sachkompetenz  |  |
Bei der historischen Sachkompetenz geht es um die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft der Schüler/innen Begriffe, Kategorien und Konzepte der Geschichte zu verstehen und anwenden zu können. Die Sachkompetenz ist damit nicht ident mit dem Sachwissen.
1.2 Historische Fragekompetenz  |  |
Durch die historische Fragekompetenz werden in den Schüler/innen jene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaft geweckt, gestärkt und entwickelt, die es ihnen ermöglichen, sinnvolle Fragen an die Vergangenheit zu stellen bzw. Fragestellungen zu erschließen.
1.3 Historische Methodenkompetenz  |  |
Die Förderung und Entwicklung der historische Methodenkompetenz soll den Lernenden jenes Rüstzeug liefern, das es ihnen erlaubt, anhand vorhandener Quellen Teile der Vergangenheit zu rekonstruieren und damit eine historische Narration zu bilden. Eine Voraussetzung ist dabei, die Quelle(n) selbst kritisch zu hinterfragen.
Ein zweiter Schwerpunkt dieser Kompetenz gilt der Dekonstruktion überlieferter Narrative, indem diese auf ihre Strukturen und den zugrunde liegenden Absichten und Interessen hinterfragt werden.
1.4 Historische Orientierungskompetenz  |  |
Die historische Orientierungskompetenz soll jene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaft bei den Schüler/innen entwickeln und stärken, die es ihnen ermöglichen sich mit Hilfe des erarbeiteten historischen Wissens und der erworbenen weiteren historischen Kompetenzen in der Gegenwart besser zurechtzufinden und sich mit Projektionen in die Zukunft auseinanderzusetzen.
IT - Hinweis
 https://hpb.univie.ac.at/online-dossiers/kompetenzen/fachwissenschaftlicher-teil/historische-kompetenzen/ Historische Kompetenz (6.4.2025) https://hpb.univie.ac.at/online-dossiers/kompetenzen/fachwissenschaftlicher-teil/historische-kompetenzen/ Historische Kompetenz (6.4.2025)
2 Politisch bildende Kompetenzen  |  |
Im Zuge der Demokratie - Initiative der österreichischen Bundesregierung erarbeitete eine Expert/innengruppe ein Kompetenzmodell zur Politischen Bildung. Mit der Aufnahme in den zu Beginn des Schuljahres 2008/9 in Kraft gesetzten neuen Lehrplans für die Sekundarstufe I erfolgt die Realisierung.
Als Kompetenzen werden jene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften definiert, die es Schüler/innen ermöglichen, selbstständig Probleme zu lösen.
Im Bereich der Politischen Bildung sind dies die folgenden Kompetenzen.
Politische Urteilskompetenz
Politische Handlungskompetenz
Politikbezogene Methodenkompetenz
Politische Sachkompetenz
2.1 Politische Urteilskompetenz  |  |
Die politische Urteilskompetenz beinhaltet die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft der Schüler/innen politische Entscheidungen, Probleme oder Konflikte eigenständig, begründet und möglichst sach- und/oder wertorientiert beurteilen zu können. Dies bezieht sich sowohl auf vorliegende Urteile, Vorurteile oder Vorausurteile wie auch auf von den Schüler/innen selbst zu prüfende, formulierende und argumentierende eigene Entscheidungen und Urteile.
2.2 Politische Handlungskompetenz  |  |
Die politische Handlungskompetenz soll die Schüler/innen befähigen den eigenen Standpunkt in politischen Fragen formulieren und artikulieren zu können. Ebenso umfasst sie die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft die Position und Bedürfnisse anderer zu verstehen und aufzugreifen und bei der Mitwirkung zur Lösung von politischen, sozialen oder ökonomischen Problemen neben den eigenen einzubeziehen. Dies schließt die Fähigkeit zu Kompromissen, zur Kommunikation, Toleranz und Akzeptanz mit ein.
2.3 Politikbezogene Methodenkompetenz  |  |
Die politische Methodenkompetenz fördert und entwickelt bei den Lernenden einerseits die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft sich Verfahren und Methoden anzueignen, mit denen sie sich mündlich, schriftlich oder visuell in der Öffentlichkeit, z.B. in Diskussionen aber auch in traditionellen oder modernen Medien artikulieren und ihre Anliegen argumentieren können. Andererseits sollen sie aber auch fertige Manifestationen des Politischen verstehen und entschlüsseln können.
2.4 Politische Sachkompetenz  |  |
Bei der politischen Sachkompetenz geht es um die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft der Lernenden Begriffe, Kategorie und Konzepte des Politischen zu verstehen und anwenden zu können.
IT - Hinweise
 https://hpb.univie.ac.at/online-dossiers/kompetenzen/fachwissenschaftlicher-teil/politisch-bildende-kompetenzen/ (6.4.2025) https://hpb.univie.ac.at/online-dossiers/kompetenzen/fachwissenschaftlicher-teil/politisch-bildende-kompetenzen/ (6.4.2025)
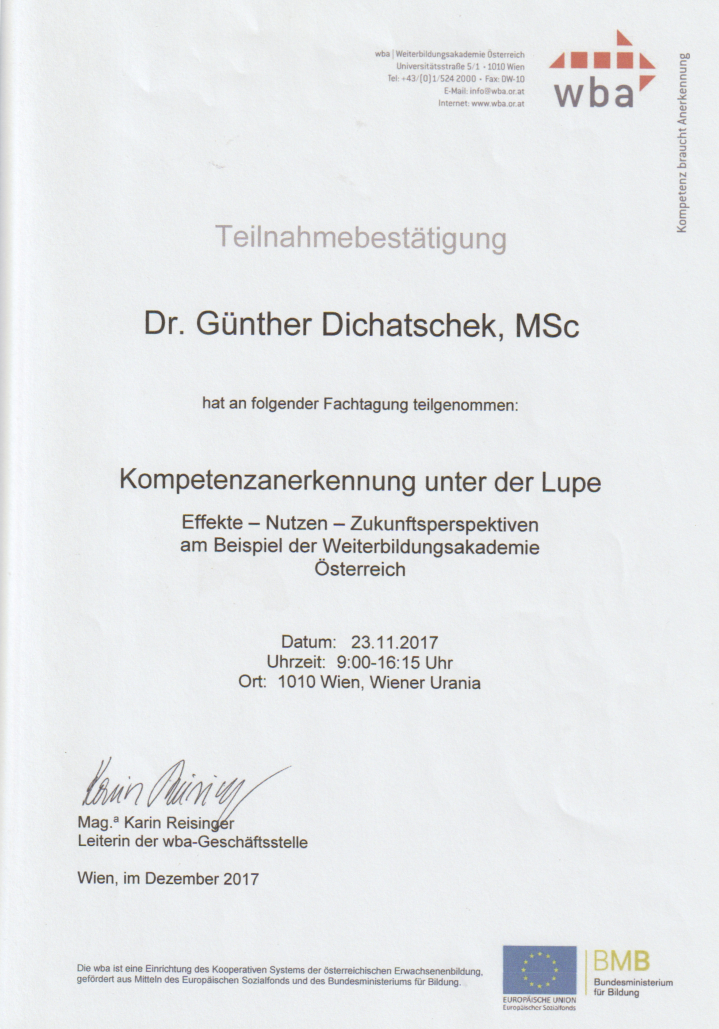
Teil II Fächerverbund  |  |
3 Schule und Politische Bildung - Unterrichtsprinzip/ Querschnittsaufgabe  |  |
Die österreichische Schule hat die Aufgabe , demokratisches Lernen zu ermöglichen und zu vermitteln (vgl. § 2 Schulorganisationsgesetz 1962 i.g.F.; Unterrichtsprinzip Politische Bildung). Schule ist nicht von ihrer Tradition und Organisation her demokratisch gehaltvoll (vgl. BEUTEL 2016, 226).
Aspekte einer Schulentwicklung sind daher von Interesse, wobei praktische Schwerpunkte skizziert und Leistungen von Forschungsansätzen und ihre Kritik angesprochen werden.
Man kann davon ausgehen, dass demokratische Erfahrung notwendig ist, um Lernende in einer demokratischen Haltung zu fördern (vgl. BEUTEL 2016, 227-228).
- Politische Handlungskompetenz mit Fertigkeiten, Fähigkeiten, Engagement und demokratischer Haltung muss erlernt werden. Dazu gehören etwa Analyse- und Urteilsfähigkeit, Diskursfähigkeit, Umgang mit kultureller und ethnischer Vielfalt, Kompromissfähigkeit und Perspektivenwechsel.
- Demokratie als politische Organisationsform unterliegt einer ständigen Herausforderung und Gefährdung. Lernen, Erziehung und Bildung sind Gegengewichte. Schule und Familie(ohne vorgegebene Erziehungsnorm) ermöglichen primäre demokratische Erfahrungen, Wissen und Handlungsmöglichkeiten, um politisches Lernen zu ermöglichen.
- Den im deutschsprachigen Raum bzw. in Österreich notwendigen Nachholbedarf kennzeichnet treffend die Charta des Europarates "Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education" (vgl. EUROPA - RATS - CHARTA 2010, 5): "Die Mitgliedsstaaten sollten eine demokratische Führung (Governance) in allen Bildungsinstitutionen fördern, sowohl als eine anzustrebende und nutzbringende Führungsmethode per se als auch als zweckmäßigen Weg, um Demokratie und Achtung der Menschenrechte zu lernen und zu erleben".
- Erziehungsbemühungen und Bildungsziel sind folgerichtig Mündigkeit und Partizipationsbereitschaft.
- Die Aufgabenbestimmung formuliert ein schulisches Ziel über die Fächer hinweg und nimmt daher alle Lehrenden mit diesem Unterrichtsprinzip/dieser Querschnittsaufgabe in die Pflicht. Die Hierarchie der Schule weist auf keine demokratische Einrichtung hin, weil Erwachsene/Lehrende Anweisungen geben und Kinder bzw. Heranwachsende/Lernende sich danach richten müssen(vgl. TILLMANN 2014, 84). Eine demokratische Atmosphäre muss daher erst geschaffen und kultiviert werden.
- Politische Bildung/Erziehung und Demokratiepädagogik sind daher eine große Querschnittsaufgabe und folgerichtig als Unterrichtsprinzip anzusehen (vgl. die Notwendigkeit auch eines eigenen Faches zur Vermittlung von Sachwissen und die gegenwärtige Stellung im Fächerkanon, insbesondere die Kombination als "Bindestrich - Fach" mit Geschichte und Sozialkunde in der Sekundarstufe I).
Wenig inhaltlich ausgeprägt in der Schulentwicklungsforschung sind politische Sozialisation und das Thema Demokratie im Sinne einer Notwendigkeit von Politischer Bildung. Beispielhaft soll dies in der Folge dargestellt werden.
- Im Handbuch für Sozialisationsforschung weist ULRICH (2001/1991, 390) schulische Sozialisation auf die schulische Funktionsstruktur hin, in der demokratierelevante Aspekte der Gerechtigkeit bzw. Ungleichbehandlung angesprochen werden - Schulversagen und Schulangst - grundsätzliches zur Politischen Bildung aber fehlt.
- Politische Sozialisation wird gerne nur unter der Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit diskutiert (vgl. KULKE 2001/1991, 595).
- Im Handbuch der Schulforschung fehlen die Stichworte "Politische Sozialisation", "Politische Bildung" und "Demokratie" (vgl. HELSPER -BÖHME 2004).
Inzwischen liegen Studien zur Verbindung eines Unterrichts in Politischer Bildung bzw. eine sozialwissenschaftlichen Unterrichts in Form von Projekten vor (vgl. STEIN 2016; RADEMACHER - WINTERSTEINER 2016). In Österreich engagiert sich das "Demokratiezentrum Wien" mit Projekten und Basisarbeit (vgl.  http://www.demokratiezentrum.org [6.9.2016]). http://www.demokratiezentrum.org [6.9.2016]).
Hinzuweisen ist auf eine fundierte Fachliteratur in Politischer Bildung, die exemplarisch im Literaturverzeichnis/"Literaturhinweise" vorzufinden ist ( vgl. zur Lehrerbildung, Fachdidaktik DICHATSCHEK 2020, 13-78).
4 Herausforderungen für Politische Bildung  |  |
Als Herausforderung für Politische Bildung gilt die Konfrontation mit totalitären bzw. autoritären Weltbildern, wobei professionelles Wissen, Empathie und Handeln pädagogische Interaktionen und Kommunikation in Verbindung mit Akzeptanz und Wertschätzung erforderlich machen (vgl. die Diskussion um ein Lehramt für Politische Bildung bzw. eine universitäre Ausbildung von Lehrenden; man beachte die bestehenden Universitätslehrgänge und ihre Professionalität für schulische und erwachsenenpädagogische Politische Bildung).
Schule agiert auf fünf Ebenen in der Vermittlung von Politischer Bildung im
Erziehungsstil (Interaktion - Kommunikation),
Fachunterricht mit reflektierendem Lernen (Fallstudien, Analysen), simulierendem Lernen (Planspiele, Simulationen) und realitätsbezogenem Lernen/ Handeln (Projekte),
fächerübergreifenden Unterricht (Unterrichtsprinzip),
in Schulkultur - standortbezogene Schulentwicklung (Partizipation - Feste - Rituale) und
in der Öffnung zum zivilgesellschaftlichen Umfeld ("community education") - Service Learning, Projektlernen, Vernetzung mit politischer Jugendarbeit/ Freiwilligendienst (vgl. HAFENEGER 2011).
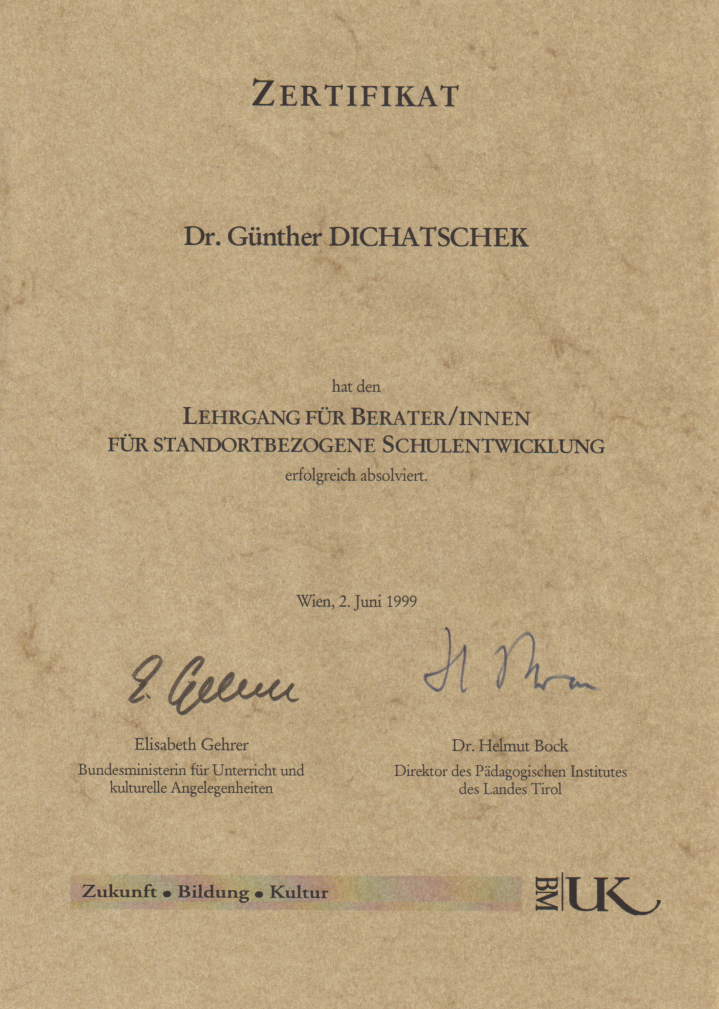
Offene Jugendarbeit stellt Heranwachsenden Räume zur Verfügung, in welchen sie sozialen und gemeinschaftlichen Umgang, Diskursfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Perpektivenübernahme/-wechsel entwickeln können. Jugendverbände ermöglichen eine politische Vorbereitung durch Aktivitäten und Beteiligungen.
Die Hochschuljugend/ Hochschülerschaft gilt mitunter als Kaderschmiede für kommende politische Eliten.
Die Erwachsenen- bzw. Weiterbildung ist vermehrt gefordert, sich mit Politischer Bildung in ihren Teilbereichen auseinanderzusetzen.
Hemmend sind die ungleichen Berufsprofile der Lehrenden und ihre fachlichen Kompetenzen.
Als förderlich gelten das Vorwissen, die Berufserfahrungen und das persönliche Engagement.
Internationale Begegnungen ergeben interkulturelle Erziehungsprozesse mit einem Abbau von Ängsten, Vorurteilen und Stereotypen sowie Lernprozessen für neue Weltbilder, Kultur- und Kommunikationsformen.
Politische Bildung unter dem Aspekt von Interkulturalität ist ein Erfordernis einer pluralen und globalisierten Gesellschaft geworden.
In der Politischen Bildung gestaltet der Lernende die Gesellschaft. Lehrende beeinflussen Lernende und umgekehrt.
Es gehört zur pädagogischen Ethik, Lernende nicht für Interessen von Erwachsenen zu funktionalisieren.
Politische Bildung hat mit nicht beabsichtigten Folgewirkungen zu rechnen. So können etwa Lippenbekenntnisse, öffentliche Meinungen, Massenmedien, Ideologien, Vorurteile und Stereotypen Meinungen bilden, die zu hinterfragen sind.
Die Gefahr von subtilen Formen von Machtausübung ist auch in offenen, demokratischen und individualisierten Lernformen gegeben (vgl. etwa moralisierende Losungen und repressive Klassenregeln).
Räume der Reflexion sind in einer Politischen Bildung notwendig und müssen praktiziert werden können (vgl. etwa die Bedeutung von Erwachsenenbildungsinstitutionen mit ihren Angeboten, institutionalisierte Foren, Leserforen, Jugendzentren, Freiwilligentätigkeiten und zivilgesellschaftliches Engagement).
Wesentlich ist die Praktizierung demokratischer Modelle mit belebenden Aktivierungen wie demokratischen Strukturen, Debatten, gegenseitigem Respekt, Ablehnung von Vorurteilen - Diskriminierung - Rassismus, Reflexion über den Bereich der IT - Einrichtungen ("digitale Demokratie") und den Randbedingungen moderner Politikgestaltung mit neuen Attributen einer Demokratie (vgl. HÖFFE 2009; MARSCHALL 2014, 104-106).
In der Unterrichts- bzw. Lehrkommunikation bilden sich bei der Wissensvermittlung mitunter typische Fallen, die eine/ -n unpolitischen Unterricht bzw. Lehre ergeben (vgl. AUTORENGRUPPE FACHDIDAKTIK 2016, 92-93):
Wissensfalle/ Kontextfalle - es bedarf eines Kontextes zur Interessenslage und der Bedürfnisse der Lernenden,
Meinungsfalle - es bedarf einer Verhinderung eines kritiklosen Relativismus, der ein Orientierungsbedürfnis Lernender behindert,
Moralisierungsfalle - Unterscheidungen von Gut und Böse sollen skeptische Fragen und Kritik unterbinden. Folgen können Denkverbote und Lippenbekenntnisse sein,
Parallelisierungsfalle - Grenzen von Analogien werden nicht aufgedeckt (Staat - große Familie, Klassenrat - unser Parlament).
4.1 Politische Bildner und Bildnerinnen 2014 - Politische Bildung in Volksschulen und Schulen der Sekundarstufe I  |  |
Im Folgenden wird auf die SORA - Studie 2014 zur Politischen Bildung in Wien eingegangen. Auftraggeber waren die AK Wien und PH Wien.
Lehrende, die einen Beitrag zur Politischen Bildung leisten sollen, stehen mitunter allen auf weitem Feld. Die Lernziele haben sich bisher nicht entsprechend in der Aus- und Weiterbildung niedergeschlagen. Mit der Gründung des "Zentrums für politische Bildung" sollen Entwürfe für Konzepte zur Vermittlung der Politischen Bildung etwa in der Aus- und Fortbildung bzw. der Organisation fachspezifischer Tagungen in den Unterricht einfließen (S. 3) (vgl. die vielen Angebote und Materialien des zentrums polis).
An der Erhebung haben 476 Wiener LehrerInnen teilgenommen - 201 Lehrende an Volksschulen und 275 Lehrende der Sekundstufe I (S. 4).
Aus der Sicht Wiener Lehrender an allgemein bildenden Pflichtschulen (APS) hat die Schule einen wesentlichen Auftrag in der Politischen Bildung von Kindern und Heranwachsenden. Auch der Kompetenzerwerb wird von allen Lehrenden anerkannt. Die Volksschule wird bereits als gefordert gesehen. Lehrende der Sekundarstufe I sehen den Freundeskreis und Freizeiteinrichtungen als wesentlich an. Lehrende an Volksschulen schreiben zudem den Eltern einen deutlichen größeren Beitrag zu (S. 5-6).
Zentrale Aufgabe der Schule ist die Vermittlung von Konfliktlösungskompetenzen (80 Prozent), das kritische und unabhängige Denken (77 Prozent) sowie das Vertreten einer eigenen Meinung (71 Prozent). Wissen über Rechte und Pflichten (55 Prozent), Analyse und Reflexion von gesellschaftlichen Zusammenhängen (52 Prozent) und Weckung von Interesse am politischen Leben (45 Prozent) folgen. Im unteren Drittel finden sich die Vorbereitung auf politische Teilhabe (41 Prozent), die Fähigkeit wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen (35 Prozent) und das Wissen über soziale und politische Institutionen (32 Prozent). Zuletzt wird die Mitbestimmung der Lernenden in der Schule benannt (32 Prozent) (S. 7-8).
Lehrende setzen kaum auf Institutionslehre, vielmehr geht es um Kompetenzen.
Auf Grund des Unterrichtsprinzips hängt die Umsetzung von Politischer Bildung stark vom einzelnen Lehrenden ab. Bei der Vorbereitung verlässt man sich auf eigene Ideen, selbstgestaltetes Material, Medien und Schulbücher. Eine untergeordnete Rolle spielen Lehrpläne und Erlässe. Vorwissen der Lernenden werden eher selten aufgegriffen. Wenn Erfahrungen der Lernenden miteinbezogen werden, wird von positiven Erfahrungen berichtet (S. 9-10).
Schuldemokratische Elemente werden eher formal mit Abstimmungen, Klassenrat und/oder Wahlen praktiziert. Nach Selbsteinschätzung der Lehrenden gelingt die Mitgestaltung und Mitbestimmung des Unterrichts durch die Lernenden nur mäßig und oftmals fehlt es an der Begleitung sowie Vor- und Nachbereitung schuldemokratischer Prozesse (S. 10).
Eine deutliche Mehrheit der Lehrenden wünscht sich mehr Fort- und Weiterbildung, allerdings hat bisher nur ein kleiner Teil davon Gebrauch gemacht (S. 12).
2014 wünschen sich Lehrende eine Ausweitung des Kombinationsfaches Geschichte/Sozialkunde/Politische Bildung auf die 6. Schulstufe (S. 12).
Identifiziert werden konnten verschiedene Typen Lehrender für Politische Bildung (S. 14):
Typ 1 - Partizipative: Interesse - Analyse - Reflexion - Mitbestimmung im Unterricht, weniger Ängste, mehr Unterrichtszeit, häufiger Fort- und Weiterbildungen
Typ 2 - Beobachtende: vertraut mit dem Unterricht, häufiger Vermittlung von Wissen, Angst vor Parteiwerbung in der Schule, Wunsch nach mehr Angeboten der Fortbildung und Unterrichtszeit
Typ 3 - Reservierte: wenig vertraut mit Politischer Bildung, mehr Befürchtungen, Wunsch nach mehr Fortbildung.
4.2 Flüchtlingskinder und -jugendliche an österreichischen Schulen/Stand 2015  |  |
Im Folgenden werden wesentliche Richtlinien zum Rundschreiben 21/2015 des Bundesministeriums für Bildung und Frauen, Abteilung I/5a, Referat für Migration und Schule referiert (vgl. GZ BMFB - 27.901/0049-I/5a/201):
Definitionen
Asylbewerber sind Personen, die in Österreich einen Asylantrag gestellt haben. Für die Durchführung sind Bundesbehörden zuständig(Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl/BFA, bei Beschwerden das Bundesverwaltungsgericht).
Anerkannte Flüchtlinge sind Personen, deren Antrag rechtskräftig positiv abgeschlossen ist.
Subsidiären Schutz genießen Personen, deren Leben und Gesundheit im Herkunftsland gefährdet ist. denen ein befristeter Aufenthalt mit Abschiebeschutz gewährt wird(vgl. die Anwendung bei Personen aus Kriegsgebieten).
Ein Bleiberecht kann Personen ohne Asylberechtigung und subsidiären Schutz gewährt werden - unter Berufung auf den Schutz des Privat- und Familienlebens(Art. 8 EMRK) - wobei eine lange Aufenthaltsdauer, die Selbsterhaltungsfähigkeit und der Grad der Integration berücksichtigt werden.
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne Eltern oder erwachsene Begleitpersonen auf der Flucht sind. 2914 haben 2 260 UMF (129 Kinder unter 14 Jahren) einen Asylantrag in Österreich gestellt. 2015 warten es in den ersten fünf Monaten 2 320 Personen (Afghanistan, Syrien und Somalia). Sobald diese Personengruppe zum Asylverfahren zugelassen und in die Landesbetreuung übernommen wurde, werden sie durch die örtliche Kinder- und Jugendhilfe vertreten.
Zahlen - Fakten
Weltweit waren 2014 fast 60 Millionen auf der Flucht. Die Steigerung von 2013 (ca. 51 Millionen) auf 2014 war die höchste der UNCHR. Syrien nimmt den Spitzenplatz mit 7,6 Millionen Binnenvertriebenen und rund 3,9 Millionen Flüchtlingen außerhalb des Landes ein (Afghanistan 2,6 Millionen, Somalia 1,1, Millionen).
Global ist die Flüchtlingszahl ungleich verteilt. 86 Prozent der Flüchtlinge befanden sich 2014 in weniger entwickelten Staaten.
Die Türkei ist weltweit das größte Aufnahmeland mit 1,6 Millionen Personen aus Syrien (Libanon 1,2 Millionen, Jordanien 654 000). Pakistan und im Iran nahmen jeweils 1,5 Millionen bzw. rund 1 Million Personen aus Afghanistan auf. Äthiopien (660 000) und Kenia (551 000)nahmen die Mehrheit der somalischen Flüchtlinge auf.
In Österreich gab es 2014 7 279, 2015 20 620 Asylanträge zwischen Jänner und Mai.
Anträge von UMF gab es von Jänner bis Mai 2015 unter 14 Jahren 132, über 14 Jahren 2 188.
Aufnahme in die Schule
Schulpflichtige Kinder haben das Recht und die Pflicht, die Schule zu besuchen. der zuständige Schulspürengel hat alle schulpflichtigen Kinder (auch Kinder von Asylbewerbern und Kinder mit nicht geklärtem aufenthaltsrechtlichen Status) aufzunehmen und nach Möglichkeit altersgemäß einzustufen. Bei räumlichen Engpässen infolge naheliegender größerer Quartiere muss der zuständige Landesschulrat eine Lösung finden. In der AHS-Unterstufe?? brauchen die AGHS außerordentliche Lernende nicht aufnehmen.
Offen stehen allen in Österreich wohnhaften Jugendlichen und Erwachsenen ungeachtet ihrer Herkunft, Erstsprache und eventueller Schulabschlüsse die Angebote der "Initiative Erwachsenenbildung" (vgl.  https://www.initiative-erwachsenenbildung.at). Ebenso kommen Kurse der Basisbildung für junge Menschen in Frage, die nicht oder unregelmäßig die Schule in ihrem Herkunftsland besucht haben. In der Folge kann dann ein Pflichtschulabschluss angestrebt werden, um einen Zugang zu einer Berufsausbildung und ggf. höheren Bildung zu finden. Ein Berufsschulbesuch im Rahmen einer Lehre steht bis 25 Jahre offen, eine überbetriebliche Ausbildung ist nicht vorgesehen, für asylberechtigte Jugendliche allerdings gegeben (vgl. die monatlichen Ankündigungen des AMS insbesondere für Mangelberufe). https://www.initiative-erwachsenenbildung.at). Ebenso kommen Kurse der Basisbildung für junge Menschen in Frage, die nicht oder unregelmäßig die Schule in ihrem Herkunftsland besucht haben. In der Folge kann dann ein Pflichtschulabschluss angestrebt werden, um einen Zugang zu einer Berufsausbildung und ggf. höheren Bildung zu finden. Ein Berufsschulbesuch im Rahmen einer Lehre steht bis 25 Jahre offen, eine überbetriebliche Ausbildung ist nicht vorgesehen, für asylberechtigte Jugendliche allerdings gegeben (vgl. die monatlichen Ankündigungen des AMS insbesondere für Mangelberufe).
Zu beachten ist jedenfalls, dass die Sprache der Kinder mit einer der offiziellen Landessprachen und ihr Religionsbekenntnis mit der im Lande vorherrschenden Religion nicht identisch ist. Gerade Minderheiten werden verfolgt, weshalb eine genaue Auskunft notwendig ist.
Im Rahmen des außerordentlichen Status an Schulen gibt es die Möglichkeit, maximal zwei Jahre an einem Sprachförderkurs teilzunehmen (vgl. § 8c, Abs. 1 Schulorganisationsgesetz i.d.g.F.).
Alphabetisierung
Für die Alphabetisierung von Seiteneinsteigern in der Zweitsprache Deutsch kann ggf. die Anstellung von Personen mit einer Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache und/oder als Basisbildner vorgenommen werden.
Muttersprachlicher Unterricht
Wesentlich ist die Rolle von Lehrenden für einen muttersprachlichen Unterricht als Mittler zwischen Schule, Eltern und Flüchtlingskind. Bei der Suche nach geeigneten Lehrenden ist das BMBF behilflich (elfie.fleck@bmbf.gv.at).
Soziale Leistungen
Unentgeltliche Schulbücher und mehrsprachige Lernsoftware ist im Rahmen der Schulbuchaktion ein Recht für alle Lernenden. Einmal darf ein zweisprachiges Wörterbuch für zwei- bzw. mehrsprachige Lernende bestellt werden.
Schülerfreifahrt
Wer sich in der Grundversorgung befindet und die Schule besucht, werden die Kosten für die Schülerfreifahrt bei Bewilligung des BM.I getragen. Ein Selbstbehalt entfällt (vgl. die Abwicklung über die Firma ORS Service GmbH im Auftrag des BM.I).
Schulbeihilfe - Teilnahme an Schulveranstaltungen
Anerkannte Flüchtlinge ab der 10. Schulstufe haben bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen nach dem Schülerbeihilfengesetz 1983 Anspruch auf Schülerbeihilfe und die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung für die Teilnahme an Schulveranstaltungen.
Unterstützende Maßnahmen
Zur Bearbeitung von Problembereichen ist eine Zusammenarbeit mit der Schulpsychologie, Bildungsberatung, den Schulberatungsstellen für Migranten, dem Österreichischen Jugendrotkreuz erforderlich bzw. möglich.
Politische Bildung
Im Rahmen des Unterrichtsprinzips und des Unterrichts in Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung sowie von Unterrichtsmaterialien des "Zentrums polis" ist eine Befassung mit Flucht und Migration im Kontext mit Medienbildung unterstützend möglich und wirksam.
Pressehinweise/ IT- Hinweise
Rundschreiben an die Landesschulräte >  http://orf.at/stories/2295318/2295243/ (25.8.2015) http://orf.at/stories/2295318/2295243/ (25.8.2015)
 http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Interkulturelle Kompetenz http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Interkulturelle Kompetenz
Organisatorische Herausforderung >  http://orf.at/stories/2295344/2295354/ (26.8.2015) http://orf.at/stories/2295344/2295354/ (26.8.2015)
Keine politische Lösung in Sicht >  http://orf.at/stories/2295568/2295569/ (28.8.2015) http://orf.at/stories/2295568/2295569/ (28.8.2015)
 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211216_OTS0216/nationalrat-startet-mit-fokus-auf-schutz-gefluechteter-kinder (6.4.2025) https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211216_OTS0216/nationalrat-startet-mit-fokus-auf-schutz-gefluechteter-kinder (6.4.2025)
Verantwortung und Stabilität des Handelns (Selbstreflexion des Handelns, eigene Verantwortlichkeit).
5 Werte als Lernprozesse - Ziele von Lehre/ Unterricht  |  |
Im Folgenden geht es um den Sinn und die Grenzen einer Wertorientierung - Lehr- bzw. Studienpläne, Parteinahme und Parteilichkeit sowie oberste Lernziele - und Merkmale eines wertbezogenen politischen Verhaltens - "richtige" Werte, moralische Urteile, demokratische Tugenden und Grundwerte bzw. Leitideen.
5.1 Sinn und Grenzen einer Wertorientierung  |  |
Es geht um evaluative Orientierung, die als Fähigkeit zu Stellungnahmen und Handeln zu verstehen ist. Neben der Erkenntnis ergänzt sie die Einsicht, was es sein soll. Erst durch das Handeln erhält sie einen Wert.
Evaluative Orientierung wird daher auch Wertorientierung benannt (vgl. GAGEL 2000, 271). Werte werden materiell (Güter), geistig - kulturell (Wissen, Bildung, Sinnorientierung) und sozial (Einfluss, Prestige, Autorität) eingestuft.
5.2 Lehr- und Studienpläne  |  |
In Lehrplänen bzw. Studienplänen werden Werte an Inhalten und Lernzielen sichtbar. Sie bilden das politische Programm der Politischen Bildung. Merkmale sind die von Hans - Hermann HARTWICH (1977) beschriebenen Indikatoren der Sozialstaaten-Modelle??.
Konservatives Sozialstaaten - Modell - Rechtsstaat, Soziale Marktwirtschaft, Verfassung, Staat als Schutz- und Korrekturfunktion, Sozialstaat als System und Zustand, Grenzen des Sozialstaates, Freiheit, Wert ist individuelle Freiheit
Progressives Sozialstaat - Modell - Sozialstaat als Auftrag in einem politischen Prozess, Zielwerte sind soziale Gerechtigkeit-Chancengleichheit??, Überwindung sozialer Ungleichheit, sozialgestaltende Interventionen des Staates, Arbeit ist Sektor der Sozialpolitik mit Beschäftigungspolitik und Wirtschaftsdemokratie.
Lehrpläne beinhalten ein (bildungs-) politisches Programm. Sie hängen von der Zusammensetzung der Lehrplan - Arbeitsgruppe, ihrem Selbstverständnis, fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kompetenz ab.
Eine Analyse von Lehrplänen beinhaltet die Inhaltskomponente mit Aussagen zum gesellschaftlichen und politischen Umfeld, den Systemrahmen und Erweiterungsmöglichkeiten sowie der Verhaltenskomponente mit wünschenswerten Fähigkeiten (wie Sachlichkeit, Verantwortlichkeit und Partizipation). Der "demokratiekompetente Bürger" mit einem Grad des Engagements wird angestrebt (vgl. zusehen, interventionsfähiger Bürger, Aktivbürger; KUHN 1999, Politische Bildung 32/1999, Heft 2, 162).
5.3 Parteinahme und Parteilichkeit vs. Indoktrination  |  |
Politische Bildung bedeutet die Auseinandersetzung mit Politik und ihren Einzelformen, sie beinhaltet daher Politik im Sinne von Inhalten und Verhalten bzw. Handlungsfähigkeit.
Politische Programme meinen die Entscheidung für eine Richtung, was auch für andere Richtungen zu gelten hat. In jedem Fall kommt es zu Entscheidungsproblemen.
Parteilichkeit für Lehrende gilt nur, wenn es um die Interessen der Lernenden geht.Dies bedeutet didaktisch chancengleiche Kommunikation und angstfreies Lernen (kompensatorische Funktion).
Denkvoraussetzungen einer Politischen Bildung haben Prämissen. Unbestreitbar gibt es gültige Aussagen über eine gesellschaftliche und politische Wirklichkeit.
Dazu gehört politisches Bewusstsein, das argumentative Offenheit beinhaltet. Subjekte haben die Chance zu erhalten, ihre Interessen definieren zu können.
Interessen allein genügen nicht. Es gilt auch, für die Zukunft offen zu sein (vgl. antizipatorisches Verhalten; Ausgleich von subjektiven und objektiven Bedürfnissen; beispielhaft: Parteinahme für eine Ökologie als politisches Problem vs. Parteilichkeit für politische Ideen wie Klimaschutzprogramme und Organisationen).
Indoktrination beinhaltet ein Verfahren, Erkenntnisse, Einsichten und Verhalten zu erzwingen (Sanktionen, einseitige Information, Verschweigen von Kontroversität oder Abqualifizierung anderer Erkenntnisse; vgl. das Überwältigungsverbot im "Beutelsbacher Konsens" 1976).
Lösungen zur Verhinderung ergeben sich aus dem bereits besprochenen strukturellen Lernen und der kognitiven Komplexität.
5.4 Ziele eines Unterrichts/ Lehre  |  |
Die Bezeichnung beinhaltet die Frage nach der Reichweite von Lernzielen.
Lernziele wecken (Lern-) Erwartungen, womit aus der Sicht einer Politischen Bildung ihre Funktion zu untersuchen ist (vgl. LOMPE 1971, 226).
Regulativ dienen sie in der Regel methodisch richtungsgebend für den Fortgang eines Lernprozesses. Sie beeinflussen die Richtung des Handelns (etwa die "Selbstbestimmung").
Operativ werden sie durch einen zu planenden Handlungsablauf realisiert. Damit sind dies Lernziele (auch Feinziele) einer Unterrichts- bzw. Lehrstunde.
Die Reichweite, also Wirksamkeit, wird bestimmt durch die Richtung des pädagogischen Handelns, wobei sie den Lehrenden helfen zu beurteilen, ob Lernende in der Unterrichtsphase einen Zuwachs (ein Mehr im Vergleich zu früher) an erhalten zu haben;
Relation zu dem früheren Zustand. Es zeigt sich, dass Lernziele nur relativ zur Biographie der Lernenden bezogen werden können. Lehrende werden demnach den Bezug zum Entwicklungsstand der Lernenden zu bedenken haben. Angestrebt wird eine Veränderung auf einen gewünschten Zustand, aber in Relation zum bisherigen;
Möglichkeit des pädagogischen (und in diesem Fall politischen) Handelns. Die gegebenen Umstände bestimmen den Spielraum der Möglichkeiten (vgl. die Unterschiedlichkeiten von Lerngruppe zu Lerngruppe und von Bildungsinstitution zu Bildungsinstitution und in jedem Fall dem jeweiligen Bildungsrahmen).
Zu fragen ist ebenfalls die Funktion oberster Lernziele in der Didaktik und Reflexion Lehrender.
Hier geht es um die Offenlegung der Normenentscheidung, also des Wertbezugs. Angesprochen ist die pädagogische Verantwortung der Lehrenden. Es geht um Zumutbarkeit und Kritikfähigkeit, in der Folge Legitimationsfähigkeit und Rechtfertigung.
Es geht auch um das Lernziel, das die Lernenden verändert(also die Richtung).
Es geht um die Auswahl und Gewichtung von Inhalten, also um das Kriterium der Bedeutsamkeit. Oberste Lernziele lassen eine Beurteilung der didaktischen Relevanz von Lerngegenständen zu. Sie ermöglichen eine didaktische Analyse und Planung von Unterricht bzw. Lehre.
5.5 Merkmale eines wertbezogenen politischen Verhaltens  |  |
Fragen ergeben sich um die Richtigkeit von Werten, moralischen Urteilen, demokratischen Verhaltensweisen, Grundwerten und Leitideen. Im Folgenden wird auf diese wesentlichen Fragen für die Didaktik näher eingegangen.
5.6 Richtigkeit von Werten  |  |
Bei dem Diskurs um Werte prallen zwei Demokratietheorien aufeinander, die Werttheorie und die Prozesstheorie der Demokratie.
Werttheorie als fixe Größe, verfassungsgemäß festgelegt und objektiv > Festlegung in der Verfassung (objektive Wirklichkeit - materiale Wertethik);
Prozesstheorie der Demokratie als politische Entscheidungsfindung, Mehrheitsregel > Wertewandel (gesellschaftliche Größe - formale Zielethik).
Für die Politische Bildung lässt sich eine Hierarchie der Werte formulieren (vgl. HEPP 1999, 144).
Menschenwürde
Gleichheit - Gerechtigkeit - Pluralität - Frieden > Grundwerte
Partizipation - Demokratisierung - Solidarität - Mündigkeit - Toleranz - Zivilcourage - Gemeinsinn > politische Werte
Verhaltens- und Sollensanforderungen - etwa Disziplin und Gehorsam > Normen und Regeln
Anders wird die Wertediskussion in der Politische Bildung bei HENKENBORG (1999, 610-616/"Reflexionstheorie der Moral") gesehen.
Politische Bildung als Erziehung zur Mündigkeit hat moralische Selbstbestimmung zum Ziel. Sie ist deshalb ein Ort für wertbezogenes Argumentieren (Zielbestimmung, Sinn- und Orientierungsfragen, Wertkonflikte).
Ethik als Reflexionstheorie der Moral in der Politischen Bildung stellt normative Fragen nach Handlungsweisen bei der Bewältigung politischer Herausforderungen("policy"), bei der Gestaltung politischer Institutionen("polity") und in politisch-gesellschaftlichen Konflikten("politics"). Begründet werden sie von einem moralischen Standpunkt("moral point of view"), der Alternativen bzw. Entwicklungen als wünschenswert ansieht(vgl. "moral education").
Didaktisch verlagern sich Wertprobleme auf eine andere Ebene. Es geht um ein sozial bezogenes Handeln. Pädagogisch relevant ist die Geltung von Werten in realen Situationen (vgl. GAGEL 2000, 303). Keineswegs wird ein wertfreier oder wertneutraler Unterricht angestrebt.
Lernenden sollen Werten im Unterricht bzw. in der Lehre begegnen.
In einer pluralistischen Gesellschaft werden Entscheidungssituationen in Politischer Bildung mit Hilfe von Werten durchdacht, ggf. auch durchlebt. Die Realität von Werten ist bewusst zu vollziehen, somit auch durch Nachdenken zu begleiten.
5.7 Struktur des moralischen Urteils  |  |
Lawrence KOHLBERGs sechs Stufen bilden ein Schema bzw. eine Hierarchie der Urteilstypen. Es zeigt sich eine Verfeinerung des moralischen Urteils von der präkonventionellen zu den postkonventionellen Stufen. Kohlberg hat die Stufen nicht nur als Hierarchie, vielmehr als Entwicklungsstufen kognitiver Fähigkeiten entworfen (vom kindlichen Stadium zum Erwachsenenstadium).
Schema der Entwicklung moralischen Bewusstseins nach KOHLBERG (vgl. GAGEL 2000, 309)
Ebene I (präkonventionell)
Werte sind Eigenschaften von externen Ereignissen
Stadium 1: Gehorsam und Orientierung an Bestrafung
Stadium 2: Naiv - egoistische Orientierung
Ebene II (konventionell)
Stadium 3: Orientierung an Bravheit
Stadium 4: Orientierung an Autorität und Aufrechterhaltung an sozialer Ordnung - Orientierung an Pflichterfüllung
Ebene III (postkonventionell)
Stadium 5: Kontraktueller Legalismus
Stadium 6: Gewissens- oder Prinzipienorientierung
Als Kompetenz des Urteilens helfen die Stufen Unterrichtsverläufe zu erkennen und zu beurteilen.
Kohlbergs Urteilsformen sind deswegen für die Politische Bildung praktizierbar, weil sie situations- und bereichsunabhängig sind, keine Verhaltensregeln beinhalten, vielmehr zu Verhaltensbegründungen auf die Struktur zurückführen. Die Formen moralischen Urteils erweisen sich genereller Natur, vernachlässigt werden situative oder kulturelle Besonderheiten.
Kritisch ist zu vermerken, dass die Gefahr einer gesinnungs-ethischen Moralisierung der Politik unter Vernachlässigung der situativen, interessens- und machtbedingten Zusammenhänge bestehen kann (vgl. SUTOR 1984, 30).
Die Unterschiedlichkeit zwischen einem moralischen Urteil und einem politischen Denken im Kontext mit moralischen Elementen zeigt sich in der Verschiedenartigkeit der Konflikte.
Kohlbergs Forschungsansatz stellt individuelle Entscheidungskonflikte in den Mittelpunkt.
Politische Konflikte besitzen Dynamik, haben eine höheren Grad an Vernetzung mit Folgewirkungen, sind wenig transparent und besitzen zumeist viele Lösungsmöglichkeiten.
Diese Komplexität erkennt man an Bernhard SUTORs Modell des politischen Entscheidungsdenkens (vgl. SUTOR 1992, 35).
Modell des politischen Entscheidungsdenkens nach SUTOR (1992)
Kategorien einer Politischen Bildung in der Problemanalyse
Vorphase: Einstieg und Planungsgespräch - Problem/Konflikt, Betroffenheit, Bedeutsamkeit, Meinungen
Erste Hauptphase: Situationsanalyse - Information, Interessen, Beteiligte - Interpretation, Ideologien, Geschichtlichkeit
Zweite Hauptphase: Möglichkeiten - Macht, Organisation, Recht/Verfahrensregeln, Institutionen, - Beteiligung - Koalition, Kompromiss, Zielkonflikte - Durchsetzung
- - -
Zwischenschritte: Information - Planungsgespräche - Zwischenzusammenfassung
- - -
Dritte Hauptphase: Urteilsbildung, Entscheidungsdiskussion - Menschenwürde - Grundkonsens/ Zumutbarkeit, Gemeinwohl - Wirksamkeit, Folgen, Verantwortlichkeit
Schlussphasen: Transfer, Kontrolle und Kommunikation
- - -
Die dritte Phase verbindet Werte und Realität, die keinesfalls einseitige Denkvorgänge sein müssen, vielmehr durchaus verknüpft werden können. Bewerten in Form einer Qualität von Begründen und politisches Handeln sind im politischen Entscheidungsdenken verbunden. In der Urteilsebene wird das Für und Wider abgewogen.
Politisch moralisch ist,
selbst zu denken,
autonom zu urteilen und zu handeln.
Reflexivität soll/ muss als Analyse und Bewertung praktiziert werden. Dies wäre das Ziel von Unterricht bzw. Lehre.
Die didaktische Funktion ergibt sich im Kohlbergschen Konzept eines moralischen Urteils aus der
diagnostischen Funktion, in dem Lehrende den Reflexionsstand der Lerngruppe bzw. der Lernenden zu einer Stufe zuordnen kann;
instrumentellen Funktion, in dem Lehrende die Diskussion lenken und den Denkprozess verbessern können;
intentionalen Funktion, in dem Lernende ihr Urteil von Stufe zu Stufe verbessern und sich an allgemeinen Prinzipien orientieren können;
autonomie - erweiternden Funktion, in dem für Lernende das Konzept als Instrument der Analyse und Bewertung eigener Urteile verwende und damit die Fähigkeit einer Reflexivität erlangt werden kann.
Die Schlüsselfrage für Lernende ist die Fähigkeit zu Stellungnahmen zu sozialen und politischen Entscheidungsproblemen mit wertbezogenen Urteilskriterien, wobei eine Abwägung zu realitätsbezogenen Kriterien vorzunehmen ist. Nur so erreicht man verantwortungsethische Urteilsfähigkeit (vgl. REINHARDT 1999, bes. 51).
5.8 Demokratische Verhaltensweisen  |  |
Denkformen zu einem moralischen Urteil besagen noch nichts über Handlungsweisen in einer konkreten Situation.
Verhaltensweisen ("Tugenden") dagegen können als vorbildlich, nachahmenswert oder ablehnenswert erscheinen. Der Begriff hat durch die Historie eine Ambivalenz erhalten, die in der Politischen Bildung zu beachten ist.
Jedenfalls stellen Verhaltensweisen - etwa Pünktlichkeit, Fleiß, Ausdauer, Sauberkeit, Verantwortlichkeit, Gründlichkeit, Redlichkeit, Respekt, Solidarität und Toleranz - keinen Wert an sich dar, vielmehr haben sie eine dienende Funktion (vgl. HÖFFE 1997, 306-309).
Durch die Unterschiedlichkeit der "Tugendkataloge" - man denke an die kirchlich-religiösen Kardinaltugenden und/ oder Tugenden des Bürgertums - muss in der Politischen Bildung nach Leitvorstellungen gefragt werden. Dies betrifft demokratische Tugenden, also Verhaltensweisen bzw. Verhaltensmuster für politisches Handeln in einem demokratischen Staat.
Dazu gehört/-en zunächst ein Systembezug mit dem Zusammenhang von Staatsform und Normorientierung, also demokratischen Grundrechten. Rolf DAHRENDORF(1965, 328-339) sprach etwa öffentliche (= soziale Werte) und private (= eigene Vervollkommnung) Verhaltensweisen im Hinblick auf die Unterschiedlichkeit zwischen der deutschen und angelsächsischen Gesellschaft an.
Durch die Unterscheidung von Politischer Bildung als Erziehung zur Demokratie als Staatsform und zur Demokratie als Lebensform kommt es zu
Unterschieden in Aspekten von demokratischen Verhaltensweisen.
Dies zeigt sich an den Beispielen als Lebensform wie Kompromissbereitschaft, Zurückhaltung, Konfliktfähigkeit, Sensibilität, Vertrauen bzw. Misstrauen, Engagement bzw. Distanz und Selbstbewusstsein (vgl. von KROCKOW 1979, 9-17).
Beispiele als Staatsform sind etwa Loyalität, Mut, Rechtsgehorsam, Kooperationsbereitschaft, Fairness, Partizipation, Argumentation, Toleranz, Respekt und Solidarität (vgl. BEYME-OFFE?? 1995, 303).
Diese Unterschiede können als Instrument zur Diagnose für Lehrende dienen, wozu die Ziele ihres unterrichtlichen Verhaltens neigen.
In der Folge können zwei Ansätze der Politischen Bildung festgemacht werden, das soziales Lernen und das politisches Lernen einschließt.
"Aber zu hören ist auch die Warnung vor einem 'unpolitischen Unterricht', der sich mit sozialem Lernen begnügt (manchmal aus der Not des fachfremd Unterrichtenden, weil man 'Lebenskunde' betreiben kann und weniger fachwissenschaftliche Kenntnisse benötigt)" (GAGEL 2000, 326).
Die didaktische Erkenntnis folgert, dass beide Aspekte sich ergänzen und damit eine Erziehung zur Demokratie in Lernziele übertragen werden, die auf politische Beteiligung bzw. politisches Handeln sich bezieht. Dies weist auf
Demokratie als Teilnahme mit Erlernen von Partizipation,
Internalisierung der öffentlichen Verhaltensweisen und
Sensibilität für soziale (und globale) Notstände mit Erlernen allgemeinen Demokratiedenkens (vgl. Mehrheit - Minderheit, Diskurs, Kompromiss, Konflikt, Argumentation, Respekt, Toleranz, Solidarität, Entscheidung).
5.9 Grundwerte - Leitideen  |  |
Es gilt die These, dass im Bundes - Verfassungsgesetz (BVG) Grundwerte festgelegt sind und diese in der/einer Politischen Bildung als Verhaltensweisen von Lernenden verinnerlicht werden sollen.
Die Verinnerlichung ist das didaktische Problem. Werte in einer Persönlichkeitsstruktur lassen sich schwer planen. Vorrangig geht es um deren Anerkennung, also um eine Motivation für ein eigenes Handeln mit dem Ziel, eine Richtschnur zu besitzen.
Weil es um ein didaktisches Vorhaben geht, sollte eher von Leitideen gesprochen werden. Angestrebt wird ein Lernprozess, in dem die grundlegenden Werte in die Persönlichkeitsstruktur integriert werden sollen.
Gemeint ist eine
Aktivierung der Vernunft und
eine Sensibilisierung des moralischen Bewusstseins/ Urteilsvermögen.
Leitideen sind regulative Ideen, die die Richtung und nicht das Ergebnis vorgeben.
Es geht also um Prinzipien des Handelns, um oberste Lernziele.
Es geht auch um deren Anerkennung, d.h. sie müssen auch zu rechtfertigen sein. In ihrer Anwendung können sie durchaus strittig sein (vgl. das Machtmonopol des Staates und den Schusswaffengebrauch).
Als Vorschlag für Leitideen können die drei bereits behandelten Themen gelten, nämlich der
Situationsbegriff (Prinzip der Gerechtigkeit),
fundamentale Probleme (Prinzip der Universalität)und
das moralische Urteil (Prinzip des praktischen Diskurses). Dazu sind Bedingungen notwendig wie Wahrheit, Argumentationsanerkennung, keine Einschränkungen beim Diskurs bei Themen und Teilnehmenden sowie der Anspruch auf Rechtfertigung, Gleichheit und Reziprozität.
Als Bezug zur Bundesverfassung stehen die Leitideen mit den Begriffen Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Frieden. Für den Lehrenden gilt die subjektive Seite mit dem Aspekt, die Werte zu hinterfragen - als Selbstprüfung, diskursive Rechtfertigung, Bestandteile eines (globalen) Ordnungssystems und Realisierungsmöglichkeit durch politisches Handeln (vgl. auch die Lernzielzusammenhang als Zusammenfassung nach GAGEL 2000, 335).
5.10 Pressehinweis  |  |
DER STANDARD ONLINE 27.2.2025
IT - Hinweis
 https://www.derstandard.at/story/3000000259181/neues-fach-demokratiebildung-mehr-autonomie-und-recht-auf-laengere-schulzeit (9.4.2025) https://www.derstandard.at/story/3000000259181/neues-fach-demokratiebildung-mehr-autonomie-und-recht-auf-laengere-schulzeit (9.4.2025)
Neues Fach Demokratiebildung, mehr Autonomie und Recht auf längere Schulzeit
Die neue Regierung setzt integrationsfördernde Schwerpunkte durch sozialindizierte Finanzierung, Deutschangebote und Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Auf nicht ganz acht Seiten sind im Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und Neos die Pläne für die "Schulische Bildung" niedergeschrieben. Darin enthalten sind ein paar Neuerungen, aber keine wirklich umstürzlerischen Reformen. Der erste Absatz "Chancengerechtigkeit steigern" meint die Weiterentwicklung des Pilotprojekts "100 Schulen – 1000 Chancen" der Vorgängerregierung für einen "sozialindizierten Chancenbonus". Schulen mit "größeren, sozialen Herausforderungen" sollen heuer 20 Millionen Euro zusätzlich erhalten, im kommenden Jahr 65 Millionen und ab dann 20 Millionen extra – die aber, wie alle Maßnahmen ab 2027, unter Budgetvorbehalt stehen, also nicht abgesichert sind.
Mehr Autonomie für Schulen
Das gilt auch für die Deutschoffensive, die "zusätzliche Mittel für Regionen mit vielen außerordentlichen Schüler/ innen" und den Ausbau der Schulsozialarbeit umfasst, die von 55 auf 90 Millionen Euro steigen und dann auf 15 Millionen sinken sollen. Im Bereich Spracherwerb und Deutschförderung werden Instrumente wie Mika - D - Kompetenzanalyse und Deutschförderklassen evaluiert und überarbeitet. Für Kinder mit "Laufbahnverlust" in der Unterstufe sollen die Schulen einfacher Mehrstufenklassen etablieren können, so wie sie überhaupt mehr Autonomie (etwa für Personalrekrutierung und Unterrichtszeitgestaltung) und insgesamt weniger ministerielle Vorgaben erhalten sollen.
Eltern müssen mitwirken
Die "Mitwirkungspflicht der Eltern" wird in einer "formellen Bildungspartnerschaft" festgelegt. Wer nicht mitmacht, bekommt es mit multiprofessionellen Teams und stufenweisen Sanktionen zu tun.
Unter "Innovationen in Schule und Unterricht" finden sich eine zeitgemäße Anpassung der Stundentafel und Lehrpläne, die Möglichkeit, Unterrichtsfächer in Fachbereichen zu organisieren, sowie ein neues Unterrichtsfach Demokratiebildung in der Sekundarstufe 1, außerdem die tägliche Bewegungseinheit. In der Oberstufe soll es mehr Spielraum für die Förderung individueller Interessen geben. Grundsätzlich plant die neue Regierung sicherzustellen, dass jedes Kind die Grundkompetenzen erlernt, die mittlere Reife am Ende der Schulpflicht soll diese garantieren.
Europäischen Islam unterrichten
In der Schule sollen "die österreichische Lebensart" vermittelt und das "liberale Demokratieverständnis" gefördert werden. Bei der Religionspädagogik wird explizit ein "Europäischer Islam" angesprochen. Die Auseinandersetzung mit Gedenkstätten wird verstärkt.
"Schule als sicherer Ort" ist ein eigener Punkt. Dazu gehören Suspendierungsbegleitung, Time - out - Formate, Gewaltprävention sowie Präventionsprogramme gegen Extremismus und Radikalisierung. Weiters geplant sind spezialisierte Reha - Klassen für, wie es heißt, "erziehungsschwierige Kinder" und für alle "klare Regelungen zur altersgerechten Umsetzung eines Handyverbots in der Schule".
Eine langgehegte Forderung betroffener Eltern ist ein Rechtsanspruch auf ein elftes und zwölftes Schuljahr für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF). Wichtig auch: Die Deckelung der SPF - Förderung wird von (unrealistischen) 2,7 auf 4,5 Prozent angehoben (beides ab 2027 unter Budgetvorbehalt). Und: Die Gemeinden sollen nicht mehr die Kosten für die Schulassistenz betroffener Kinder übernehmen müssen.
Gemeinsame Schule kein Thema
Vor einer gemeinsamen Schule muss sich niemand fürchten, Modellregionen sollen dazu erleichtert, Ganztagsschulen, bei "lückenloser" Wahlfreiheit, ausgebaut und polytechnische Schulen sowie Berufsschulen aufgewertet werden. Lehrkräften werden "moderne Arbeitsplätze" und Karrieremöglichkeiten versprochen, Schulleitungen im Pflichtschulbereich höhere Zulagen (Lisa Nimmervoll, 27.2.2025).
Literaturhinweise - Politische Bildung  |  |
Adorno T. (1977): Erziehung zur Mündigkeit, Frankfurt/ M.
Arthur J. - Davies I. - Hahn C. (2008): The Sage Handbook of Education for Citizenship and Democracy, Los Angeles
Autorengruppe Fachdidaktik (2016): Was ist gute politische Bildung? Leitfaden für den sozialwissenschaftlichen Unterricht, Schwalbach/ Ts.
Behrmann G.C. (1972): Soziales System und politische Sozialisation. Eine Kritik der neueren politischen Pädagogik, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz?
Benner D. (Hrsg.) (1998): Erziehungsstaaten, Weinheim
Berger Th. (1979): Gefühl der Ratlosigkeit. in: betrifft: erziehung, Heft 1/1979, 18-19
Berger P.L. - Berger Br. (1976): Wir und die Gesellschaft. Eine Einführung in die Soziologie - entwickelt an der Alltagserfahrung, Reinbek
Besand A.-Gessner S. (Hrsg.) (2018): Politische Bildung mit klarem Blick, Festschrift für Wolfgang Sander, Schwalbach/Ts.
Beutel W. (2016): Demokratiepädagogik als Querschnittsaufgabe aktueller Schulentwicklung, in: Die Deutsche Schule, Heft 3/2016, 226-238
Beutel W. - Fauser P. (Hrsg.) (2007): Demokratiepädagogik. Lernen für die Zivilgesellschaft, Schwalbach/ Ts.
Beutel S.-I./ Beutel W. (2012): Beteiligt oder bewertet? Leistungsbeurteilung und Demokratiepädagogik, Schwalbach/ Ts.
Beyme von Kl. - Offe Cl. (1995): Politische Theorien in der Ära der Transformation, PVS Sonderheft 26/ 1995, 295-324
Biermann P./ Hennig E./ Leder H./ Müller D./ Pacho N./Schauermann E./ Sponholz J.-U./ Steiner Gr./ Wazinski H. (Hrsg.) (2016): Politische Bildung im Alter, Schwalbach/ Ts.
Bohl T./ Helsper W./ Holtappels H.-G./ Schelle C. (Hrsg.) (2010): Handbuch Schulentwicklung, Bad Heilbrunn
Borcherding K. (1965): Weg und Ziele politischer Bildung in Deutschland, München
Böttiger Fr. (2010): Politische Bildung in der Sozialen Arbeit, Saarbrücken
Brandner A. (1982): Schule und Politische Bildung III, Klagenfurt
Bruner J.S. (1970): Der Prozess der Erziehung, Düsseldorf
Bundesgesetzblatt vom 25. Juli 1962 über die Schulorganisation
Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Erlass "Politische Bildung in den Schulen", Zl. 33.464/6-19a/1978, wiederverlautbart mit GZ 33.466/103-V/4a/94
Claußen B. (1981): Methodik der politischen Bildung, Opladen
Claußen B. - Geißler R. (Hrsg.) (1996): Die Politisierung des Menschen. Instanzen der politischen Sozialisation, Opladen
Dachs H. (1975): Zwischen Anpassung und Reform. Zur Theorie der Politischen Bildung in der BRD seit 1945, in: Zeitgeschichte, Heft 4/1975, 99-107
Dachs H. (1978): Unterwegs zur politischen Bildung, in: schulheft 1/1978, 48-56
Dachs H. (1979): Politische Sozialisation, in: Zeitgeschichte, Heft 5/1979, 188-198
Dahrendorf R. (1965): Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, München
Deichmann C. (1996): Mehrdimensionale Institutionenkunde in der politischen Bildung. Kleine Reihe Bd. 13, Didaktik und Methodik, Schwalbach/Ts.
Deichmann C. (2004): Lehrbuch Politikdidaktik. Lehr- und Handbücher der Politikwissenschaft, München-Wien?
Deichmann C. - Partetzke M. (Hrsg.) (2018): Schulische und außerschulische politische Bildung, Wiesbaden
Dengel S. (2007): Untertan, Volksgenosse, Sozialistische Persönlichkeit. Politische Erziehung im Deutschen Kaiserreich, dem NS - Staat und der DDR, Frankfurt/ M.
Detjen J. (2000): Bürgerleitbilder in der politischen Bildung, in: Politische Bildung Heft 4/2000, 19-38
Dichatschek G. (1979): Menschenrechte und Menschenwürde im Unterricht der Sekundarstufe I, in: Zeitgeschichte, Heft 4/1979, 148-156
Dichatschek G. (2008): Geschichte und Theorieansätze der politischen Bildung/Erziehung in Österreich - unter besonderer Berücksichtigung vorberuflicher Bildung/Erziehung - Master Thesis zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science/ Politische Bildung (152 Seiten), Universitätslehrgang MSc - Politische Bildung, Alpen-Adria? Universität Klagenfurt/ Fakultät für Kulturwissenschaften, Klagenfurt
Dichatschek G. (2017a): Geschichte und Theorieansätze der politischen Bildung in Österreich, Saarbrücken
Dichatschek G. (2017b): Didaktik der Politischen Bildung. Theorie, Praxis und Handlungsfelder der Fachdidaktik der Politischen Bildung, Saarbrücken
Dichatschek G. (2020): Lehrerbildung. Theorie und Praxis der Professionalisierung der Ausbildung Lehrender, Schulleitender und des Schulqualitätsmanagements, Saarbrücken, 13-78
Dörner D. (1989): Die Logik des Misslingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen, Reinbek
Drechsler H. - Hilligen W. - Neumann F. (1995): Gesellschaft und Staat. Lexikon der Politik, München
Eichhorn L. (2014): Politische Bildung im Sachunterricht: Fiktion oder Realität?, Saarbrücken
Ellwein Th. (1955): Pflegt die deutsche Schule Bürgerbewusstsein? Ein Bericht über die staatsbürgerliche Erziehung an den höheren Schulen der Bundesrepublik, München
Ellwein Th. (1960): Was geschieht in der Volksschule? Berlin - Bielefeld
Erath M. (2013): Die Bedeutung der Politischen Bildung im österreichischen Bildungssystem, Saarbrücken
Erziehung und Unterricht/ Schwerpunktnummer "Politische Bildung in der Schule", 3-4/ 2016, Wien
Filzmaier P. - Ingruber D.(2001): Politische Bildung in Österreich. Erfahrungen und Perspektiven eines Evaluationsprozesses, Innsbruck
Fischer K.G. (1970): Einführung in die Politische Bildung. Ein Studienbuch über den Diskussions- und Problemstand der Politischen Bildung in der Gegenwart, Stuttgart
Fischer K. G. (1978): Emanzipation, in: Wulf Chr., Wörterbuch der Erziehung, München, 156-160
Fischer K.G. (1993): Das Exemplarische im Politikunterricht, Schwalbach/ Ts.
Fischer K.G. - Herrmann K. - Mahrenholz H. (1978): Der politische Unterricht, Bad Homburg - Berlin - Zürich
Gagel W. (Hrsg.) (1992): Politische Bildung nach der Vereinigung, Politische Bildung 25/1992, Heft 2, Bonn
Gagel W. (2000): Einführung in die Didaktik des politischen Unterrichts - Ein Studienbuch, Opladen
Georgi V. (2009): The Making of Citizen in Europe, Bonn
Germ A. (2009): Politische Bildung im Geographie- und Wirtschaftskundeunterricht, Saarbrücken
Giesecke H. (1965/1976/1979): Didaktik der politischen Bildung, München
Giesecke H. (1993): Politische Bildung. Didaktik und Methodik für Schule und Jugendarbeit, Weinheim
Grammes T. (1998): Kommunikative Fachdidaktik, Opladen
Grammes T. - Welniak Chr. (2012): Politische Erziehung, in: Sandfuchs U. - Melzer W. - Dühlmeier B. - Rausch A.(Hrsg.): Handbuch Erziehung, Bad Heilbrunn, 676-681
Greiffenhagen M. (Hrsg.) (1973): Demokratisierung in Staat und Gesellschaft, München
Grossmann R. - Wimmer R. (1979/1980): Schule und Politische Bildung I - II, Klagenfurt
Habermas J. (1968): Verwissenschaftlichte Politik und öffentliche Meinung, in: Habermas J. (Hrsg.): Technik und Wissenschaft als "Ideologie", Frankfurt/ M., 121-127
Habermas J.(1981): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 1, Frankfurt/ M.
Hafeneger B. (Hrsg.) (2011): Handbuch außerschulische Jugendbildung, Schwalbach/ Ts.
Hamann R. (1974): Politische Soziologie für den Sozialkundeunterricht, Hamburg
Hartwich H. - H. (1977): Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher Status quo, Opladen
Haselwanter M. (2015): Möglichkeiten Politischer Bildung in Anbetracht von Krieg, islamischem Terror und Flucht, in: Schreiber H. - Jarosch M.- Gensluckner L. - Haselwanter M. - Hussl El. (Hrsg.): Gaismair - Jahrbuch 2016. Zwischentöne, Innsbruck - Wien - Bozen, 87-95
Hauk D. - Partetzke M. (2014): der Weg zum Ziel - Politikdidaktische Ansätze und kompetenzorientierte Politikdidaktik, in: Behrens R.(Hrsg.): Kompetenzorientierung in der politischen Bildung, Schwalbach/ Ts., 33-41
Händle Chr. - Oesterreich D. - Trommer L. (1999): Aufgaben politischer Bildung in der Sekundarstufe I. Studien aus dem Projekt Civic Education, Opladen
Heinemann G.W. (1977): Präsidiale Reden, Frankfurt/ M.
Heintel P. (1976): Politische Bildung - Ein Fach?, in: Zeitgeschichte, Heft 11/12 1976, 364-377
Heintel P. (1977): Politische Bildung als Prinzip aller Bildung, Wien
Hellmuth Th. - Klepp C. (2010): Politische Bildung, Wien - Köln - Weimar
Helsper W. - Böhme J. (Hrsg.) (2004): Handbuch der Schulforschung, Wiesbaden
Henkenborg P. (1999): Ethik, in: Mickel W.W. (Hrsg.): Handbuch zur politischen Bildung, Schwalbach/ Ts., 610-616
Hennis W. (1968): Das Modell des Bürgers, in: Hennis W.(Hrsg.): Politik als praktische Wissenschaft. Aufsätze zur politischen Theorie und Regierungslehre, München, 201-212
Hepp G. (1999): Die Wertediskussion, in: Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 358, Bonn, 143-149
Hierlemann D. - Vehrkamp R.B. - Wohlfahrt A. (2013): Inspiring Democracy. New Forms of Public Participation, Bielefeld
Hilligen W. (1985): Zur Didaktik des politischen Unterrichts, Opladen
Hilligen W. (1991): Didaktische Zugänge in der politischen Bildung, Schwalbach/ Ts.
Himmelmann G. (2001): Demokratie - Lernen als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform, Schwalbach/ Ts.
Himmelmann G. - Lange D. (Hrsg.) (2010): Demokratiedidaktik, Wiesbaden
Holtmann A. (1970): Lehr- und Lernmittel im politischen Unterricht. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Heft 89, Bonn
Höffe O. (1997): Lexikon der Ethik, München
Höffe O. (2009): Ist die Demokratie zukunftsfähig, München
Huddy L. - Sears D.O.-Levy S. (Ed.) (2013): Handbook of Political Psychology, Oxford
Hufer Kl. - P. (2010): Emanzipation: ein Rückblick auf eine nach wie vor aktuelle Leitidee, in: Lösch B. - Thimmel A. (Hrsg.): Kritische politische Bildung. Ein Handbuch, Schwalbach/ Ts., 13-24
Hufer Kl. - P. (2016): Politische Erwachsenenbildung. Plädoyer für eine vernachlässigte Disziplin, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1787, Bonn
Hufer Kl.- P./ Lange D. (Hrsg.) (2016): Handbuch Politische Bildung, Schwalbach/ Ts.
Ichilov O. (2003): Education and democratic citizenship in a changing world, in: Huddy L. - Sears D.O. - Levy S.(Eds.): Oxford Handbook of Political Psychology, Oxford, 637-669
Jaeggi U. (1970): Macht und Herrschaft in der Bundesrepublik, Frankfurt/ M.
Juchler I. (2005): Demokratie und politische Urteilskraft. Überlegungen zu einer normativen Grundlegung der Politikdidaktik, Schwalbach/ Ts.
Kant I. (1995): Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Toman R. (Hrsg.): Kant - Werke in sechs Bänden, Bd. 6, Köln, 162-170
Krockow von Chr. (1979): Ethik und Demokratie. Aus Politik und Zeitgeschichte B 49/79, 8.12.1979, 9-17
Krüger H. - H. (1999): Entwicklungslinien und aktuelle Perspektiven einer Kritischen Erziehungswissenschaft, in: Sünker H./ Krüger H. - H. (Hrsg.): Kritische Erziehungswissenschaft am Neubeginn?, Frankfurt/ M., 162-183
Kost A. - Massing P.- Reiser M. (Hrsg.) (2020): Handbuch Demokratie, Frankfurt/ M.
Kucher - Kamnik M. (2013): Politische Bildung in der Grundschule, Saarbrücken
Kulke C. (2001/1991): Politische Sozialisation und Geschlechterdifferenz, in: Hurrelmann K. - Ulich D. (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim - Basel, 595-613
Lange D. - Reinhardt V. (Hrsg.) (2007): Basiswissen Politische Bildung. Handbuch für den sozialwissenschaftlichen Unterricht, Bd. I, Baltmannsweiler
Lampe K. (1971): Gesellschaftspolitik und Planung, Freiburg
Lösch B. - Thimmel A. (Hrsg.)(2010): Kritische politische Bildung. Ein Handbuch, Schwalbach/ Ts.
Luger M. (2013): Die Rolle von Politischer Bildung im Lehramtsstudium, Saarbrücken
Luhmann N. (1984): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt/ M.
Marschall St. (2014): Demokratie, Schriftenreihe Bd. 1426, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn
Markert W. (1973): Erwachsenenbildung als Ideologie. Zur Kritik ihrer Theorien im Kapitalismus, München
Massing P. (1999): Theoretische und normative Grundlagen politischer Bildung, in: Cremer W.-Beer W.-Massing P. (Hrsg.): Handbuch zur politischen Erwachsenenbildung, Schwalbach/Ts., 21-60
Massing P. (2002a): Bürgerleitbilder und Medienkompetenz, in: Weißeno G. (Hrsg.): Politikunterricht im Informationszeitalter. Medien und neue Lernumgebungen, Schwalbach/Ts., 39-50
Massing P. (2002b): Demokratie-Lernen? oder Politik-Lernen??. in: Breit G.-Schiele S. (Hrsg.): Demokratie-Lernen? als Aufhabe der politischen Bildung, Schwalbach/Ts., 160-187
Massing P. (2014): Institutionenkundliches Lernen, in: Sander W. (Hrsg.): Handbuch politische Bildung, Schwalbach/Ts., 295-301
Massing P. - Niehoff M. (Hrsg.) (2014): Politische Bildung in der Migrationsgesellschaft, Schwalbach/Ts.
Mauric U. - Staudinger Th. (2016): LehrerInnenkompetenz?(en) aus der Sicht von Schülerinnen und das damit verbundene Potenzial für Global Citizenship Education, in: Erziehung und Unterricht, Mai/ Juni 5-6/ 2016, 431-439
Misselwitz H. (1991): Politische Bildung in den neuen Ländern: In Verantwortung für die Demokratie in ganz Deutschland, in: Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament", B 37-38/91, 6.9.1991, 3-8
Mittnik Ph. (Hrsg.) (2016): Politische Bildung in der Primarstufe - Eine internationale Perspektive, Innsbruck - Bozen
Mollenhauer Kl. (1968): Erziehung und Emanzipation, München
Müller St. (2021): Reflexivität in der politischen Bildung, Frankfurt/ M.
Moritz P. (1999): Reduktion von Komplexität, in: Mickel W.W. (Hrsg.): Handbuch zur politischen Bildung, Schwalbach/ Ts., 178-184
Oelkers J. (2009): John Dewey und die Pädagogik, Weinheim - Basel
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft/ÖZP 1996/1: Schwerpunktthema "Politische Bildung", Wien
Oetinger F. (1956): Partnerschaft - die Aufgabe der politischen Erziehung, Stuttgart
Patzelt W. (2008): Bildungskanon für die politische Systemlehre, in: Weißeno G. (Hrsg.): Politikkompetenz. Was Unterricht zu leisten hat, Bonn, 108-121
Pelinka A. (2016): Mit der Geschwindigkeit einer Schnecke. Politische Bildung in Österreich, in: Erziehung und Unterricht 3-4/2016, 160-167
Rabko K. (2017): Wählen ab sechzehn. Politische Bildung in der Sekundarstufe, Saarbrücken
Rademacher H. - Wintersteiner W. (Hrsg.) (2016): Jahrbuch Demokratiepädagogik, Bd. 4 - 2016/17: Friedenspädagogik und Demokratiepädagogik, Schwalbach/Ts.
Reinhardt S. ((1997): Didaktik der Sozialwissenschaften. Gymnasiale Oberstufe. Sinn, Struktur, Lernprozesse, Opladen
Reinhardt S. (1999): Werte - Bildung und politische Bildung. Zur Reflexivität von Lernprozessen, Opladen
Richter D. (Hrsg.) (2007): Politische Bildung von Anfang an, Bonn
Rothe Kl. (1992): Was ist wichtig? Fundamentale Lernaufgaben des Politikunterrichts in der Zukunft, Politische Bildung 25/ 1992, Heft 2, 47-57
Rohlfes J. - Körner H. (Hrsg.) (1970): Historische Gegenwartskunde. Handbuch für den politischen Unterricht, Göttingen
Salomon G. - Cairns E. (Hrsg.) (2010): Handbook on Peace Education, New York
Schachinger H.E. (2014): Psychologie der Politik. Eine Einführung, Bern
Schäfer H. (Hrsg.) (2016): Praxistheorie. Ein soziologisches Forschungsprogramm, Bielefeld
Schausberger N. (1970): Politische Bildung als Erziehung zur Demokratie, Wien
Schausberger N. (1971): Wesen und Aufgaben der Politischen Bildung, Wien
Schausberger N. (1972): Zur Didaktik der Politischen Bildung, in: Beiträge zur Lehrerfortbildung, Bd. 7, Wien, 9-43
Schausberger N. (1976): Zum Problem einer Fachdiktatur der "Politischen Bildung", in: Erziehung und Unterricht, Wien, 267-268
Schissler J. (1977): Pluralismus über alles? Das Konsensproblem in der Didaktik der politischen Bildung, in: Materialien zur Politischen Bildung 1977,, Heft 3, 81-86
Schluss H. (Hrsg.) (2007): Indoktrination und Erziehung, Wiesbaden
Schmiederer R. (1972): Zwischen Affirmation und Reformismus. Politische Bildung in Westdeutschland seit 1945, Frankfurt/ M.
Schmiederer R. (1974): Zur Kritik der Politischen Bildung, Frankfurt/ M.
Schmiederer R. (1977): Politische Bildung im Interesse der Schüler, Köln
Schweifer A. (2014): Didaktische Konzepte zur Friedenserziehung am Beispiel der UNO, Saarbrücken
Seiler Th. B. (1973): Die Theorie der Kognitiven Strukturiertheit von Harvey, Schroder und Mitarbeitern, in: Seiler Th. B. (Hrsg.): Kognitive Strukturiertheit, Stuttgart, 27-62
Shell Deutschland Holding (Hrsg.) (2006): Jugend 2006. Eine pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt/ M.
Shell Deutschland Holding (Hrsg. (2010): Jugend 2010. Eine pragmatische Jugend behauptet sich, Frankfurt/ M.
Spranger E. (1963): Gedanken zur staatsbürgerlichen Erziehung, Bochum
Springer E. (1972): Politische Bildung. Schlagwort - Pauschalurteil - Manipulation, Wien
Stein H.-W. (2016): Demokratisch handeln im Politikunterricht. Projekte zur "Demokratie als Herrschaftsform", Schwalbach/ Ts.
Sturzenhecker B. (2011): Demokratiebildung - Auftrag und Realität in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, in: Schmidt H. (Hrsg.): Empirie der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Wiesbaden
Schwerpunktnummer Die Deutsche Schule 2/ 2020: Politische Bildung und Schule, Münster
Sutor B. (1977): Konsens und Dissens in der politischen Bildung, in: Materialien zur Politischen Bildung 1977, Heft 4, 104-109
Sutor B. (1984): Neue Grundlegung politischer Bildung, Bd. II, Paderborn
Sutor B. (1992): Politische Bildung als Praxis. Grundzüge eines didaktischen Konzepts, Schwalbach/Ts.
Tillmann K.-J. (2014): Der alltägliche Umgang mit Widersprüchen. Demokratieerziehung in einem hierarchischen Schulsystem, in: Beutel W./ Gille M./ Seifert A./ Stecher L./ Tillmann K.-J.(Hrsg.): Schüler 2014. Engagement und Partizipation, Jahresheft des Friedrich - Verlags, Seelze, 84-87
Tschetsch H. (2017): Politische Theologie im Islam, Saarbrücken
Ulich K. (2001/1991): Schulische Sozialisation, in: Hurrelmann K. - Ulich D. (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim -Basel, 377-396
Vilmar F. (1973): Strategien der Demokratisierung, Bd. I: Theorie der Praxis, Bd. II: Modelle und Kämpfe der Praxis, Darmstadt - Neuwied
Weinbrenner P. (1992): Lernen für die Zukunft - Plädoyer für ein neues Relevanzkriterium der Politischen Bildung, in: Sander W. (Hrsg.): Konzepte der Politikdidaktik. Aktueller Stand, neue Ansätze und Perspektiven, Hannover, 219-238
Weißeno G. (1990): Lernertypen und Lernerdidaktiken, in: Theorie und Praxis der politischen Bildung, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 290, Bonn, 209-227
Weißeno G. - Detjen J. - Juchler I. - Massing P. - Richter D. (2010): Konzepte der Politik - ein Kompetenzmodell, Schriftenreihe der Bundeszentale für politische Bildung, Bd. 1016, Bonn
Welniak Chr. (2011): Wie Jugendliche die Gesellschaft verstehen, Hamburg
Widmaier B. - Zorn P. (Hrsg.)(2016): Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens? Eine Debatte der politischen Bildung, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1793, Bonn
Wintersteiner W. (2016): Friedenserziehung - ein Kernbestandteil Politischer Bildung, in: Erziehung und Unterricht 3-4/ 2016, 225-235
Wirtitsch M. (2016): Politische Bildung 2016, in: Erziehung und Unterricht 3-4/2016, 173-179
Wohlfahrt H. (2010): Der politische Gehalt des Neuen Testaments, Saarbrücken
Wolf A. (Hrsg.) (1998): Der lange Anfang. 20 Jahre "Politische Bildung in den Schulen", Wien
Wulf Chr. (1973): Kritische Friedenserziehung, Frankfurt/ M.
Zeglovits E. (2018): Wählen mit 16 - ein österreichisches Erfolgsmodell?, in: Erziehung und Unterricht 3-4/ 2018, 257-263
Zouhar K. (2009): Politische Bildung im Mathematikunterricht, Hamburg
Literaturhinweise - Historische Elemente  |  |
Bahl Fr. (1975): Spiegel der Zeiten Bd. 1: Von der Vorzeit bis zum Ende der Alten Welt, Frankfurt/ M. - Berlin - München
Bruckmüller E. (2021): Geschichte kompakt: Österreich, Wien
Busley H.(1975): Spiegel der Zeiten Bd. 2: Vom Frankenreich bis zum Westfälischen Frieden, Frankfurt/ M.- Berlin - München
Hellmuth Th. (Hrsg.) (2017): Politische Bildung im Fächerverbund, Wiener Beiträge zur Politischen Bildung 5, Schwalbach/ Ts.
Hoffmann J. (1976): Spiegel der Zeiten Bd. 4: Von der Russischen Revolution bis zur Gegenwart, Frankfurt/ M. - Berlin - München
Mager H. - E. (1977): Spiegel der Zeiten Bd. 3: Vom Absolutismus bis zum Imperialismus, Frankfurt/ M. - Berlin - München
Vocelka K. (2002): Geschichte Österreichs Kultur - Gesellschaft - Politik, München
Winkelbauer Th. (Hrsg.) (2024): Geschichte Österreichs, Ditzingen
Dokumentation  |  |
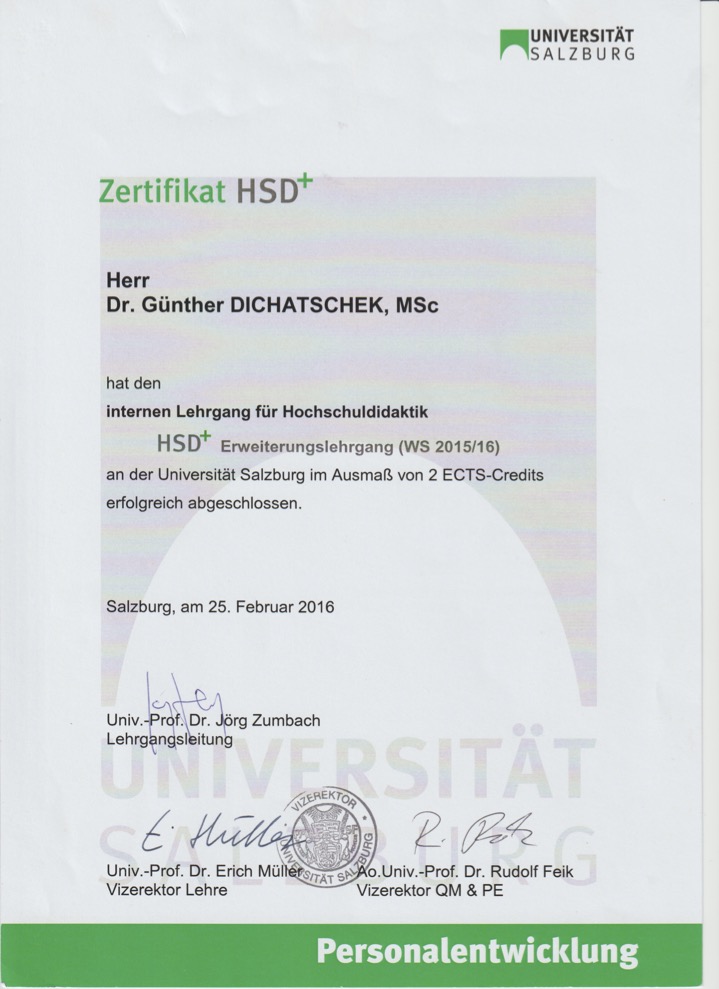
Zum Autor  |  |
APS - Lehrer/ Lehramt für Volks- und Hauptschule (D, GS, GW) sowie Polytechnischer Lehrgang (D, SWZ, Bk); zertifizierter Schüler- und Schulentwicklungsberater; Lehrbeauftragter am Pädagogischen Institut des Landes Tirol/ Berufsorientierung bzw. Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für APS - Lehrer/ Landesschulrat für Tirol (1994 - 2003)
Lehrbeauftragter am Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft/ Universität Wien/ Aus- und Weiterbildung/ Vorberufliche Bildung (1990/ 1991- 2010/2011); Lehrbeauftragter am Sprachförderzentrum des Stadtschulrates Wien/Interkulturelle Kommunikation (2012); Lehrbeauftragter am Fachbereich für Geschichte/ Universität Salzburg/ Lehramt "Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung/ "Didaktik der Politischen Bildung" (2015/ 2016, 2017)
Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche in Österreich A. und H.B. (2000 - 2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks in Tirol (2004 - 2009, 2017 - 2019)
Kursleiter an den VHSn Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg - "Freude an Bildung" (2012-2019) und VHS Tirol "Der Wandel der Alpen" -
Politische Bildung (2025)
Absolvent des Instituts für Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ Master (2008), des 6. Universitätslehrganges Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012) - des 6. Lehrganges Interkulturelles Konfliktmanagement/ Bundesministerium für Inneres - Österreichischer Integrationsfonds/ Zertifizierung (2010), der Weiterbildungsakademie Österreich/ Diplome (2010), des 1. Lehrganges Ökumene/ Kardinal König - Akademie Wien/ Zertifizierung (2006) - der Personalentwicklung für Mitarbeiter der Universitäten Wien/ Bildungsmanagement/ Zertifizierungen (2008 - 2010) und Salzburg/ 4. Lehrgang für Hochschuldidaktik/ Zertifizierung (2015/2016) - des Online - Kurses "Digitale Werkzeuge für Erwachsenenbildner_innen"/ TU Graz - CONEDU - Werde Digital.at - Bundesministerium für Bildung/ Zertifizierung (2017), des Fernstudiums Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium - Comenius Institut Münster/ Zertifizierung (2018), des Fernstudiums Nachhaltige Entwicklung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium - Comenius Institut Münster/ Zertifizierung (2020)
Aufnahme in die Liste der Sachverständigen für den NQR/ Koordinierungsstelle für dem NQR, Wien (2016)
 MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net
|